Ein Überblick über alle Urkunden


Nummer 1
Adolf I. (von Altena), Erzbischof von Köln, erklärt, dass Gozewijn IV., Herr von Valkenburg, mit Zustimmung seiner Gemahlin, Frau Jutta, seinen Hof in Münstergeleen mit allen Leibeigenen, Einkünften und Zugehörigem und der Hälfte des dortigen Patronatsrechts dem Kloster Sankt-Marien in Heinsberg und dem Ort des heiligen Gerlach geschenkt hat. Er tat dies, um den versprochenen, aber nicht durchgeführten Kreuzzug nach Jerusalem zu kompensieren. Adolf I. entbindet im Gegenzug Gozewijn IV. von seinem Versprechen und stellt ihn von künftigen Strafen für dessen Bruch frei.
Adolf I. (van Altena), Erzbischof von Köln, erklärt, daß Gozewijn IV., Herr van Valkenburg, als Entschädigung für seinen unvollendeten Kreuzzug mit Zustimmung seiner Gemahlin Jutta seinen Hof zu Münstergeleen mit allen Leibeigenen, Einkünften und Zugehörigkeiten und der Hälfte des dortigen Patronatsrechts dem Kloster Sint-Marie in Heinsberg und dem Ort Sint Gerlach geschenkt hat.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Sint-Gerlach Kloster in Houthem, Inv.-Nr. 74, Reg.-Nr. 1. Gefüttert. Beschädigt mit Verlust von Text. Laut b befand sich das Original 1869 noch im Besitz von Ch. Guillon, Notar in Roermond.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1° von der Hand des 14/15. Jahrhunderts: De bonis [...]b[.]ock prope Monstergeleen. - 2°von der Hand des letzten Viertels des 14. Jahrhunderts: B j. - 3ovon der Hand des 17. Jahrhunderts: 1202. - 4ovon der Hand des 18. Jahrhunderts: Num. 69.
Siegel: zwei hängend befestigte Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Adolf I. (van Altena), Erzbischof von Köln, aus braunem Wachs, beschädigt. - S2 von Gozewijn IV, Herr van Valkenburg, aus braunem Wachs, beschädigt; und eine Befestigungsstelle für das angekündigte Siegel von Jutta, Ehefrau van Gozewijn IV, Herrin van Valkenburg (LS3). Für eine Beschreibung und Abbildung von S1 und S2 siehe Venner, 'Siegel Kloster Sint-Gerlach', 150 bzw. 156.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 113-115, unter der Überschrift: Littera confirmationis domini Adulphi, archiepiscopi Coloniensis, de bonis in Munsterglene, und am Rande: Num. 69, mit Angabe von drei Siegelstellen, nach A.
Ausgaben
a. Franquinet, Aufzeicnung Inventar Sint-Gerlach, IV, 1-3, Nr. 1, nach A. - b. Habets, 'Houthem-Sint-Gerlach', 203-206, Nr. 3 (datiert 1202), nach B.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar von Sint-Gerlach, 67, Reg. Nr. 1. - Idem, Chronologisches Verzeichnis, 34, Reg. Nr. 51. - REK, II, 331-332, Nr. 1620.
Datierung
Die Verwendung des Weihnachtsstils wird in Übereinstimmung mit der Verwendung durch den Erzbischof von Köln in dieser Zeit angenommen, siehe Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, XVI. Darin wird der terminus antequem durch die angegebene fünfte Indiktion angegeben, die bis zum 23. September lief. In der Datumszeile ist ein fehlerhaftes concurrens angegeben, man erwartet dort die Ziffer 1.


Nummer 1
Der römische König Otto I. verleiht seinem Vasallen Ansfried das Münz- und Marktrecht von Kessel, das im Gouw Maasland liegt. Von nun an darf Ansfried auch den Zoll in Echt in Kessel erheben. Die Verleihung erfolgt durch Einmischung von Herzog Coenraad.
<Rooms-koning Otto I schenkt aan zijn leenman Ansfried de munt- en marktrechten te Kessel en bepaalt dat de tol van Echt naar Kessel wordt verplaatst.>
Scheinbares Original
<A>. Maastricht, HCL, toegangsnr. 01.187A, archief Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, inv. nr. 1.
Ausgabe
a. Gysseling en Koch, Diplomata Belgica, 369-370, nr. 219, naar <A>.
Unauthentizität
Die vorliegende Urkunde wird aus paläographischen Gründen als Falsum betrachtet, siehe die Ausgabe bei Gysseling.
Lokalisierung
Für die Identifizierung von Casallum mit Kessel stimmen wir mit der Ausgabe von Gysseling und Koch überein, sowie mit Gysseling, Toponymisches Wörterbuch, 560, und Van Berkel und Samplonius, Niederländische Ortsnamen, 117. Die von anderen Autoren wie Kesselt, Neeroeteren und Kessenich vorgeschlagenen Orte (siehe u.a. Kluge, Deutsche Münzgeschichte, 27-36, und Baerten, "Les Ansfrid", 1145) erscheinen uns aus sprachlicher und namentlicher Sicht unwahrscheinlich.
Datierung
In der Datatio wird als Datum das Inkarnationsjahr 966 angegeben, mit entsprechenden Datierungselementen. In Anlehnung an die Ausgabe von Sickel, Monumenta Germaniae DO I 210, Nr. 129, wird die Urkundenfälschung in der Ausgabe von Gysseling und Koch auf das Jahr 950 datiert.


Nummer 1
Adelbert van Saffenberg und sein Sohn Adolf schenkten der Abtei Kloosterrade Besitzungen im Lande Rode, darunter fünf Höfe in Rode, die Zehnten dort und im Hof Spekholz, Besitzungen auch in Ahrweiler, die von Embrico und seinem Vater stammen, zwei von Pfalzgraf Siegfried geschenkte Höfe in Crombach, und die Domäne von Koenraad in Morsbach, vorbehaltlich der Vormundschaft, mit der sie und Bischof Otbert von Lüttich den Brüdern das Recht einräumen, einen Oberen zu wählen, Kinder von Freigelassenen zu taufen, sie zur Kommunion zuzulassen und sie zu bestatten.
Adelbert van Saffenberg und sein Sohn Adolf stiften der Abtei Kloosterrade Besitzungen im Lande Rode, darunter fünf Höfe in Rode, die Zehnten dort und im Hof Spekholz, Besitzungen u.a. in Ahrweiler, die von Embrico und seinem Vater stammen, zwei Höfe in Crombach, die der Pfalzgraf Siegfried geschenkt hat und die Herrschaft Koenraad in Morsbach an die Abtei Kloosterrade, vorbehaltlich der Vormundschaft, mit der sie und Bischof Otbert von Lüttich den Brüdern das Recht einräumten, einen Oberen zu wählen, Kinder von Freigelassenen zu taufen, sie zur Kommunion zuzulassen und sie zu begraben.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 673.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 1-9, Nr. 1, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 1
(Römisch) König Heinrich IV. bestätigt die Schenkung von Otto, Markgraf von Thüringen, und seiner Frau Aleid ihrer Güter in Weert und Dilsen an das Sint-Servaaskapitel in Maastricht gegen dreihundert Pfund Silber und den Nießbrauch von Oijen, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk und Hees.
(Römisch) König Heinrich IV. bestätigt die Übertragung der Güter in Weert und Dilsen durch Otto, Markgraf von Thüringen, und seine Frau Aleid an das Sint-Servaaskapitel in Maastricht gegen dreihundert Pfund Silber und den Nießbrauch an Oijen, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk und Hees.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 883.
Siegel: eine Befestigungsstelle für das angekündigte aufgedruckte Siegel Heinrichs IV., mit Resten von weißem Wachs, nicht vorhanden (SD1).
Abschriften
B. 1282 April 6, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 884, Urkunde des römischen Königs Rudolf I, nach A, siehe Collectie Sint-Servaaska[ittel, Nr. 46. - C. spätes 13. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 5v-6r (= neues fol. 22v-23r), Nr. 8, nach A. - D. spätes 13. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 18r-18v (= neues fol. 35r-35v), Nr. 40, zu B. - E. 1640, Ibidem, idem, Inv. Nr. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 13-14, unter der Überschrift: 9, Henricus quartus Romanorum rex confirmat donationem factam per marchionem Ottonem (im Folgenden quoad durchgestrichen) de Thuringia quoad Werdt, an A. - F. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehem.) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jh., Inv. Nr. 199a (Kartulatur) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, S. 87, unter der Überschrift: Henricus quartus, Romanorum rex, confirmat donationem factam per marchionem Ottonem de Thuringia quoad Weerdt, die 11ma calendas octobris anno 1062, beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, an [C].
Ausgaben
a. Posse, Codex Diplomaticus, 320-321, Nr. 120, nach D. - b. Gladiss und Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-1, 118-120, Nr. 91, nach A. - c. Gysseling und Koch, Diplomata Belgica I, 383-384, Nr. 230, nach A. - d. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 279-280, Nr. 39a (unvollständig), nach b und dem Argument von Deeters, Servatiusstift, 51-52. - f. DiBe ID 3906, zu c.
Zusammenfassungen
Siehe DiBe ID 3906.
Authentizität und Entstehungsgeschichte
Die Echtheit der vorliegenden Urkunde wird seit dem späten neunzehnten Jahrhundert angezweifelt. Giesebrecht, Geschichte, 1100-1101, war der erste, der sich zu diesem Thema äußerte und sich dabei auf die seiner Meinung nach fragwürdige Anwesenheit von "Godefridi, marchionis" in Deutschland sowie auf die Erwähnung des Markgrafen von Thüringen und des Grafen von Brüssel stützte. Er führte jedoch keine paläographischen oder diplomatischen Untersuchungen durch. Posse, Codex Diplomaticus, 80, verweist zwar auf Giesebrechts Einwände gegen diese Charta, doch wird das Dokument in seiner Ausgabe nicht als Falsum aufgeführt.
Niermeyer, Onderzoekingen, 172-179, war der erste, der die Urkunde von 1062 - in seiner Studie über die Lütticher und Maastrichter Urkunden - einer gründlichen Untersuchung unterzog. Er stellte aus paläographischen Gründen fest, dass die vorliegende Urkunde nicht im 11., sondern in der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden sein muss, und schrieb das Falsum einem Skribenten namens Hand S. zu. Nach seiner Meinung verfasste diese Person auch den Kontext der gefälschten Urkunde Heinrichs V. von 1109 für das Sint-Servaaskapitel in Maastricht (siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 3). Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-1, 118-119, schloss sich dieser Meinung an. Ihm zufolge beruht die vorliegende Urkunde von 1062 auf einer unverdächtigen Urkunde des Kanzlers Fredericus B. (zu seiner Tätigkeit als einer der Notarii in der Kanzlei des römischen Königs Heinrich IV. siehe Gladiss und Gawlik, o.c., XXIX-XXXI).
Niermeyer war nicht nur davon überzeugt, dass die Urkunden von 1062 und 1109, die er für Fälschungen hielt, von ein und derselben Hand geschrieben wurden - Gladiss war derselben Meinung - er machte diesen Schreiber auch verantwortlich für eine interpolierte Zeile in einer Urkunde des römischen Königs Karl III. für das Sint-Servaaskapitel von 1146 (Original in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/9; für eine Edition, siehe Camps, ONB I, 71-73, Nr. 46). Nach Niermeyer, a.a.O., 177, wäre die Urkunde Konrads III. von 1146 - mit Ausnahme der interpolierten Zeile - vom königlichen Kanzleischreiber Arnold A. geschrieben worden. Dies erscheint uns jedoch unwahrscheinlich, da seine Kanzleitätigkeiten sich laut Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, XXII, von April 1138 bis Sommer 1140 abspielen. Außerdem identifiziert Hausmann den Schreiber des Urkundentextes nicht mit Arnold A., sondern mit dem Kaplan Heribert, der von 1140 bis 1146 und 1151 in der königlichen Kanzlei tätig war. Nach Hausmann, a.a.O., 268, Nr. 147, hat der Fälscher versucht, Heriberts Schrift in dieser interpolierten Zeile zu imitieren (für einen Überblick über die von Heribert erstellten Urkunden, seine Identifizierung und seine Arbeit für die königliche Kanzlei siehe Hausmann, a.a.O., 258-273).
Ausgehend von der Feststellung, dass die Interpolation in der Urkunde von 1146 von dem Schreiber verfasst wurde, der auch die Urkunden für das Sint-Servaaskapitel aus den Jahren 1062 und 1109 mundiert hat, schließt Niermeyer, dass diese beiden Falsa nach 1146 und vermutlich nach dem Tod des römischen Königs Konrad III. im Jahr 1152 entstanden sind. Als möglichen terminus ante quem nennt er ca. 1174, das Jahr, in dem er diese Schreibhand noch in einer Urkunde Kaiser Friedrichs I. fand (Niermeyer, o.c., 176, Anm. 3). Schließlich datiert er beide Falsa genauer um 1160, ohne dies näher zu begründen. Gladiss vertritt die Auffassung, dass die Falsa von 1062 und 1109 um die Mitte des zwölften Jahrhunderts im Zusammenhang mit langwierigen Diskussionen zwischen Propst und den Kanonikern des Sint-Servaaskapitels entstanden sein könnten.
Auch Gysseling und Koch, Diplomata Belgica I, 383-384, Nr. 230, halten die vorliegende Urkunde von 1062 ohne weitere Begründung für ein in Maastricht hergestelltes Falsum. Aus paläographischen Gründen können sie jedoch der Argumentation von Niermeyer nicht zustimmen, der die Fälschung auf die Zeit um 1160 datiert, und postulieren, dass die scriptio am Ende des 11. Jahrhunderts liegen muss.
Nach Niermeyer, o.c., 175-177, ist das Diktat in der vorliegenden Urkunde aus unverdächtigen Urkunden des Fredericus B., Kanzler des römischen Königs Heinrich IV. übernommen. Aber er identifiziert eine Reihe von Bestimmungen in der dispositio, die er für verdächtig hält: 1. wo es heißt, dass Weert und Dilsen nicht dem Propst unterstellt werden, sondern dass der Dekan sie mit dem Rat der Brüder einem Bruder anvertrauen wird, den er wünscht und für geeignet hält; 2. dass Oijen, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk und Hees "ad fratrum prebendam" gehören; 3. dass niemand die Vogtei beanspruchen kann außer dem, der von den Brüdern gewählt wird; 4. die sanctio mit der hohen Geldstrafe. Diese Textstellen führen Niermeyer aus inhaltlichen Gründen zu 1128/1130 als terminus a quo für die Entstehung der Urkunde von 1062, denn die Streitigkeiten zwischen dem Propst von Sint-Servaas einerseits und dem Dekan und den Brüdern andererseits erscheinen erstmals in einer Urkunde vom 13. Juni 1128 (Original in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/5; für eine Edition siehe Ottenthal und Hirsch, Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza, 14-15, Nr. 12), sowie weil eine Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1130 eine gegen den Propst gerichtete Klausel enthält (Kopie in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 10180, fol. 171r; für eine Teiledition siehe Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 288-289, Nr. 59).
Gladiss stimmt mit Niermeyer überein, was die Diktatentlehnungen an den Urkunden vonKanzler Fredericus B. sowie die verdächtigen Textstellen betrifft.
Deeters, Servatiusstift, hält die vorliegende Urkunde ebenfalls für ein Falsum und folgt Niermeyer und Gladiss hinsichtlich der Diktatentlehnung aus einer echten Urkunde des römischen Königs Heinrich IV. Er verweist auf die Rasur mit der Interpolation in der Urkunde von 1146 und hält es auf dieser Grundlage für wahrscheinlicher, das Jahr 1146 als Bezugspunkt für den Zeitpunkt der Fälschung der Urkunde von 1062 zu nehmen, wahrsccheinlicher als das Ende des 11. Jahrhunderts, wie von Gysseling und Koch vorgeschlagen. Als terminus ante quem schlägt er ca. 1165 vor und stützt sich dabei auf die Verwendung der gleichlautenden Bußformel in einer Urkunde des römischen Königs Konrad III. aus dem Jahr 1146 für das Sint-Servaaskapitel (Original in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/10; für eine Edition siehe Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, 508-510, Nr. 293). Diese Urkunde von 1146 ist ein Falsum, das laut Hausmann um 1165 von einem Lütticher Schreiber ausgestellt wurde. Deeters folgt Niermeyer hinsichtlich der verdächtigen Textstellen weist aber auch darauf hin, dass der wesentliche Inhalt in einer erzählenden Quelle im späten 11. Jahrhundert Bestätigung findet. Tatsächlich wird die Übertragung durch Otto, Markgraf von Thüringen und seine Frau an das Sint-Servaaskapitel von Jocundus in seiner Vita von Sint-Servaas erwähnt, die zwischen ca. 1070 und 1087 geschrieben wurde (siehe die Ausgabe von Köpke, "Iocundi translatio s. Servatii", 117, caput 63). Allerdings hält er vor allem drei Textstellen für gefälschte Einschübe: die Beseitigung des Propstes ("hac conditione ... committat"), die freie Wahl der Vogtei durch die Klosterbrüder ("et ne quis advocatiam ... eligerent") und die ungewöhnlich hohe Geldstrafe ("si quis huic traditioni ... potestati").
Bezüglich des eingeprägten Siegels gibt Niermeyer, a.a.O., 174, an, dass eine Urkunde König Heinrichs IV. vom 14. Oktober 1062 für die Abtei von Verdun als Vorbild diente (Original in Reims, Archives municipales et communautaires de Reims, Sammlung P. Tarbé, Carton I, Nr. 21; für eine Edition siehe Gladiss und Gawlik, a.a.O., 120-121, Nr. 92). Ihm zufolge wurde diese Urkunde von Fredericus D., der in den Jahren 1062-1065 in der königlichen Kanzlei arbeitete, sowohl redigiert als auch mundiert. Bei diesem Kanzler handelt es sich um den von Gladiss erwähnten Fredericus B. Gladiss hält ihn zwar für das Diktat der Charta für die Abtei von Verdun verantwortlich, ist sich aber bezüglich der scriptio unsicher, die auch von einem unbekannten ingrossator stammen könnte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Urkunde sowohl aufgrund ihres Aussehens als auch aufgrund ihres Inhalts verdächtig ist. Das Entstehungsdatum dieses Falsums liegt nach Gysseling und Koch, Niermeyer, Gladiss und Deeters zwischen dem Ende des 11. und etwa der Mitte des 12. Jahrhunderts, mit dem äußersten Terminus ante quem um 1174.
Wir stimmen nicht mit Niermeyers Feststellungen zur Identifizierung von Handschriften überein. Paläografische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Urkunden von 1062 und 1109 keine handschriftliche Ähnlichkeit aufweisen, wie von ihm behauptet und von Gladiss übernommen. Die Handschriften von 1062 und 1109 weisen zwar eine starke Verwandtschaft auf, sind aber nicht identisch. Nach Niermeyer war dieser Skriptor S, der sowohl die vorliegende Urkunde als auch das falsum von 1109 sowie die interpolierte Zeile auf der Rasur in einer Urkunde von 1146 geschrieben haben soll, bis 1174 tätig. Die handschriftliche Ähnlichkeit der vorliegenden Urkunde mit der interpolierten Zeile in der Urkunde von 1146 kann unseres Erachtens nicht akzeptiert werden, da es unmöglich ist, dies anhand einer einzigen Zeile festzustellen. Folglich ist der von Niermeyer formulierte terminus ante quem, der auf den obigen Identifikationen und der angenommenen Tätigkeit dieses Skriptors S bis ca. 1174 beruht, nicht haltbar. Damit ist auch der von Deeters vorgeschlagene Richtspunkt 1146 für das Entstehungsdatum der vorliegenden Urkunde hinfällig.
Die Entstehungszeit der vorliegenden Urkunde, die Gysseling und Koch auf das Ende des 11. Jahrhunderts datieren, lässt sich weder bestätigen noch widerlegen. Die typisch diplomatische Minuskelhandschrift kann sowohl auf das Jahr 1062 als auch auf das Ende des 11. Jahrhunderts datiert werden. Folglich kann eine Mundierung im Jahr 1062 nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
Dass die Schriftin der Urkunde von 1062 nicht in den Urkunden des römischen Königs und Kaisers Heinrich IV. auftaucht, ist kein Argument für einFalsum. Dabei wird die Möglichkeit einer Destinatarisierung aus den Augen verloren . Insbesondere unter König Heinrich IV., Heinrich V. und Lothar nahm die Zahl der Destinatarisationen zu, vgl. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 462. Dass dies unbedingt zu berücksichtigen ist, zeigt die beträchtliche Anzahl von Königsurkunden Heinrichs IV., die von seiner Kanzlei im Zeitraum 9. März 1062- 2. Oktober 1064 nicht ausgestellt wurden (siehe Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-1, Nr. 83, 84, 88, 89, 132 und 136, datiert 1062 März 9, 1062 März 13, 1062 Juli 13, 1062 Juli 19, 1064 Juli 19 und 1064 Oktober 2). Eine interessante Mischform wurde übrigens in einer Urkunde des römischen Königs Heinrich IV. vom 14. Oktober 1062 gefunden, die vom destinataris redigiert wurde und in der nur das Eschatokoll vom Kanzler Friedrich B. hinzugefügt wurde (siehe Gladiss, o.c., Nr. 92). Auch eine scriptio des destinataris, das Sint-Servaaskapitel in Maastricht, passt in die Zeit kurz nach dem Staatsstreich von Kaiserswerth im April 1062, der zu ungewöhnlich schnellen, weitreichenden personellen Veränderungen in der königlichen Kanzlei führte (vgl. Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches, 287-288; Gladiss, o.c., XXIX-XXX).
Nicht nur hinsichtlich der paläographischen Identifikationen von Niermeyer sind wir anderer Meinung, auch an seiner Diktatanalyse haben wir Zweifel. Für die Redactio des Falsums soll das Sint-Servaaskapitel einige Urkunden aus dem Jahr 1063 verwendet haben, die von Kanzler Fredericus B. verfasst wurden (für eine Edition der fraglichen Urkunden siehe Gladiss, o.c., Nr. 100, 106 und 117). Nicht nur die Auswahl dieser Urkunden kann in Frage gestellt werden (Nr. 100 wurde nicht von Fredericus B. herausgegeben), sondern auch die Diktatszugehörigkeit. Niermeyer greift willkürlich auf diese und andere Urkunden zurück und identifiziert Textabschnitte, die wohl eine Anlehnung an das Diktat des Fredericus B. belegen sollen, doch das Gegenteil ist der Fall. Es gibt nicht nur erhebliche Diskrepanzen, sondern sehr auffällige Textentlehnungen und Konstruktionen finden sich bereits in älteren, von der Kanzlei redigierten Urkunden König Heinrichs IV (Gladiss, o.c, Nr. 3, 21, 47, 50 und 73, datiert 29. Dezember 1056, 28. Mai 1057, 5. Februar 1059, 4. März 1059 und 7. August 1061) sowie in Destinatarisierungsurkunden (Gladiss, o.c., Nr. 60 und 101, datiert 22. November 1059 und 14.Juni 1063). Für Diktatentlehnungen aus den von Fredericus B. redigierten königlichen Urkunden von 1063 gibt es also keine eindeutigen Beweise, während weitere Diktatvergleiche zusätzlich die Möglichkeit von Entlehnungen aus älteren königlichen Urkunden aufzeigen. Eine Bearbeitung des Urkundentextes durch das Sint-Servaaskapitel ist daher naheliegend, möglicherweise sogar auf der Grundlage einer älteren königlichen Urkunde. Ein möglicher Versprecher, der sich auf "ad usum confratrum" statt auf das übliche "ad usus fratrum" bezieht, scheint implizit in diese Richtung zu weisen. Der Urkundentext ist im Übrigen perfekt an die politische Konstellation nach dem so- genannten Kaiserswerther Putsch Anfang April 1062 angepasst, bei dem die Regentschaft über den kleinen Heinrich seiner Mutter Agnes entzogen und auf Anno, den Erzbischof von Köln, übertragen wurde. Die Formulierung "ob interventum ac petitionem dilecte genitricis nostre Agnetis imperatricis auguste", die in den Urkunden Heinrichs IV. vor April 1062 üblich ist, fehlt daher in der vorliegenden Urkunde.
Anknüpfend an die paläographischen Befunde, die Niermeyer zu einem extremen Entstehungsdatum des falsum um 1174 führten, suchte er nach stichhaltigen Argumenten gegen die aus seiner Sicht verdächtigen Textstellen zur Stellung des Propstes. Dabei berief er sich insbesondere auf Urkunden aus den Jahren 1128/1130 und 1130, in denen erstmals Streitigkeiten zwischen Propst und Kapitel erwähnt werden und eine gegen den Propst gerichtete Klausel auftaucht. Auf der Grundlage dieser Urkunden aus dem 12. Jahrhundert hielt er die Bestimmungen gegen den Propst in der vorliegenden Urkunde für unmöglich. Die Tatsache, dass vor 1128/1130 keine anderen Urkunden erhalten sind, in denen Konflikte oder der Ausschluss des Propstes erwähnt werden, ist jedoch kein Argument dafür, die Bestimmungen von 1062 als vorweggenommen oder als falsum zu bezeichnen.
Eine Urkunde aus dem Jahr 1050 könnte weiteren Aufschluss über eine mögliche unabhängige Stellung des Kapitels vor 1062 geben. Darin überträgt Godfried II. mit dem Bart von Lothringen das Allodium in Ramioul an das Sint-Servaaskapitel "ad usum fratrum ibidem Deo et sancto Servatio famulantium ... eo iure et libertate qua possedi ... et ut nullum advocatum habeant preter advocatum altaris sancti Servatii, scilicet ipsum regem". Leider kann diese Urkunde für die Echtheit der vorliegenden Urkunde keine Rolle spielen, da sie vom Sint-Servaaskapitel als Falsum aus dem zwölften Jahrhundert betrachtet wird (Original in Lüttich, Staatsarchiv, Archiv der Abtei Val-Saint-Lambert, Nr. 2; für eine Edition sowie Literaturhinweise auf Roland, Despy, Dierkens und Guilardian u. a. siehe DiBe 3402). Die Handschrift dieses Falsums, dessen Entstehungsdatum zwischen 1100 und 1200 schwankt, zeigt übrigens eine enge schreiberische Verwandtschaft mit der vorliegenden Urkunde.
Auch das in 1062 erwähnte hohe Bußgeld kann nicht als Kriterium für ein Falsum aufgrund des exzeptionellen Charakters herangezogen werden. Diese Eintragung kann ebensogut ein erstes frühes und/oder außergewöhnliches Zeugnis sein. Deeters greift, den paläographischen Erkenntnissen Niermeyers folgend, eine exakt identische Bußgeldformel in einer um 1165 gefälschten Urkunde des Sint-Servaaskapitels aus dem Jahr 1146 auf, um sie als "Vorlage" für die Urkunde von 1062 und damit als terminus ante quem anzusehen. Die Argumentation lässt sich jedoch auch umkehren: Da dieses Falsum um 1165 entstanden ist, kann die Bußgeldklausel auch aus der vorliegenden Charta von 1062 übernommen worden sein.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Besitzübergabe selbst in der Dispositio unumstritten ist, da sie durch eine erzählende Quelle aus dem 11. Jahrhundert bestätigt wird, und auch dass für die von Niermeyer vorgebrachten inhaltlichen Argumente, die für die Beurteilung der vorliegenden Urkunde als Falsum entscheidend wären, keine weiteren Belege gefunden werden konnten. Nicht nur die Korrektur der paläographischen Befunde Niermeyers eine Datierung in das 12. Jahrhundert unwahrscheinlich, auch eine scriptio im Jahre 1062 kann aus paläographischen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Die Diktatanalyse führt auch zu anderen Schlussfolgerungen, die eine Destinatisierung sehr wahrscheinlich machen. Eine Fälschung der vorliegenden Urkunde scheint uns daher nicht erwiesen.
Lokalisierung
Nach Driessen, 'Silva Ketela', col. 101-106, ist silva, Ketela dicta mit dem Ketelwpud, dem Reichswald oder 'Königlichem Wald' von Nimwegen zu identifizieren. Gysseling und Koch können diesen Ort nicht lokalisieren (unbekannt).


Nummer 2
Reinier, Dekan, und das Kapitel Unserer-Lieben-Frau in Maastricht erklären, dass Lambert Sutor und seine Mutter mit ihrer beider Zustimmung Äcker in Houthem an das Kloster Sint-Gerlach in Houthem verkauft haben. Diese Felder waren Abgabenpflichtig an das Kapitel. Der Verkauf wurde von Willem, Pfarrer in Houthem und Kanoniker des Kapitels Unserer-Lieben-Frau, veranlasst.
Reinier, Dekan, und das Kapitel Unserer Lieben Frau in Maastricht erklären, daß Lambert Sutor und seine Mutter durch die Hand ihres Mitkanonikers Willem, Pfarrer, mit ihrer Zustimmung zum Kapitel dem Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) cijnspflichtige Felder in Houthem verkauft haben.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Sint-Gerlach Kloster in Houthem, Inv.-Nr. 38, Reg.-Nr. 3.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1°von einer Hand ausdem 13. Jahrhundert: Littera terreLambertiSutoris de Houtheim et matris eiusdem en parum valet. - 2° von der Hand des letzten Viertels des 14. Jahrhunderts: U j. - 3° von der Hand des 17. Jahrhunderts: 1231.- 4°von der Handdes 18. Jahrhunderts: Num. 80.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 des Kapitels Unserer Lieben Frau in Maastricht, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 155.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 126-127, unter der Überschrift: Renuntiatio domini decani et capituli beate Marie in Trajecto super certos census ex bonis in Holtheijm, und am Rande: Num. 80, unter Angabe einer Siegelstelle, zu A.
Ausgabe
a. Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 5-6, Nr. 3, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 68, Reg.-Nr. 3. - Idem, Chronologische Liste, 39, Reg.-Nr. 69.
Datierung
Es wird angenommen, daß die Bischöfe von Lüttich um 1230 vom Weihnachtsstil zum Osterstil übergingen und daß die religiösen Einrichtungen des Bistums erst einige Zeit später folgten, siehe Camps, ONB I, XXI.Folglich wurde für die Datierung der vorliegenden Urkunde dieVerwendung des Weihnachtsstils angenommen.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 2
Der römische König Otto III. überträgt Ansfried das Eigentum an den Gütern, die der Graf bisher zu Lehen hatte, mit allen damit verbundenen Vorteilen, unter anderem an Grundstücken, Gebäuden, Gewässern und Straßen. Außerdem darf Ansfried entscheiden, was mit all dem geschehen soll. Dazu gehören ein Teil de Zölle, der Münze und der Cijns in Medemblik sowie Güter, die sich in der Grafschaft Friesland und in dem Land Niedermaas befinden. Otto nimmt diese Eigentumsübertragung durch die Fürsprache seiner Mutter Theophano vor.
Der römische König Otto III. schenkt dem Grafen Ansfried auf Fürsprache der Kaiserin Theofano und auf Intervention des Erzbischofs von Mainz sowie der Bischöfe von Worms und Lüttich einen Teil der königlichen Einkünfte aus Zoll, Münze und cijns in Medemblik, die dieser bisher als Lehen innehatte, sowie die königlichen Lehen in der Grafschaft Friesland und im Nedermaasland.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 2 (stark beschädigt).
Ausgabe
a. Koch, OHZ I, 100-103, Nr. 54, nach A.


Nummer 2
Papst Calixtus II. bestätigt auf Ersuchen von Abt Richer und den Kanonikern von Kloosterrade die Lebensregel der Abtei, nimmt die Abtei und alle ihre Güter in seinen Schutz, veranlasst die Wahl des Abtes und bestimmt, dass die Zehnten der von ihr bewirtschafteten Güter der Abtei gehören.
Papst Calixtus II. bestätigt auf Ersuchen von Abt Richer und den Kanonikern von Kloosterrade die Lebensregel der Abtei, nimmt die Abtei und alle ihre Güter in seinen Schutz, veranlasst die Wahl des Abtes und bestimmt, dass die Zehnten der von ihr bewirtschafteten Güter der Abtei gehören.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 674.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 9-12, Nr. 2, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 2
Kaiser Heinrich IV. erhebt das Sint-Servaaskapitel in Maastricht zum Reichskapitel, reserviert die Propstei dem königlichen oder kaiserlichen Kanzler und die Vogtei über den Sint-Servaasaltar sich selbst und seinen Rechtsnachfolgern .
Kaiser Heinrich IV. erhebt das Sint-Servaaskapitel in Maastricht zum Reichskapitel, reserviert die Propstei dem königlichen oder kaiserlichen Kanzler und die Vogtei über den Sint-Servaasaltar sich selbst und seinen Rechtsnachfolgern .
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 36. Beschädigt mit Verlust des Textes.
Siegel: ein aufgedrucktes Siegel, nicht angekündigt, nämlich: S1 von Kaiser Heinrich IV, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1 und seine problematische Zuordnung, siehe Venner, "Zegels", Nr. 41.
Abschriften
B. Dezember 1232 , Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 39, Einschub in eine Urkunde Kaiser Friedrichs II., an A. - C. zweites Viertel 13. Jh., Ibidem, idem, Inv. Nr. 37, Vidimus des Maastrichter Onze-Lieve-Vrouwkapitels, an A. - D. 15. Oktober 1273 , Ibidem, idem, Inv. Nr. 40, Vidimus von Meister Boudewijn von Autre-Église, Kanoniker des Domkapitels zu Lüttich und Beamter von Lüttich, an B. - E. 1282 April 9, Ibidem, idem, Inv. Nr. 42, Einfügung in eine Urkunde des römischen Königs Rudolf I., an B. - F. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehem.) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartular) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, S. 101-103, unter der Überschrift: Diploma Henrici quarti, regis et imperatoris, quo ecclesia Sancti Servatii declarat omnino libera ab omni iurisdictione, solum tantum sub rege et imperatore qui etiam solus habet collationem prepositure et avocatie altaris sancti Servatii in eadem ecclesia, datum Aquisgrani, indictione X 1087, beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, nach A.
Ausgaben
a. Nelis, 'Examen', 13-14, an A. - b. Muller und Bouman, OSU I, 225, Nr. 251, an A. - c. Gysseling und Koch, Diplomata Belgica I, 384-386, Nr. 231, an A. - d. Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV, VI-2, 522-523, Nr. 395, an A. - e. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit 311-312, Nr. 96c (unvollständig), an d. - f. DiBe ID 5153, an d.
Zusammenfassungen
Siehe Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-2, 522, Nr. 395, und DiBe ID 5153.
Authentizität und Entstehungsgeschichte
Die vorliegende Urkunde wird seit dem neunzehnten Jahrhundert nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aufgrund ihrer äußeren Merkmale als Falsum betrachtet. Stumpf-Brentano, Die Reichskanzler, 240-241, Nr. 2886, argumentiert, dass diese Urkunde ein Pseudo-Original ist. Nach Waitz, Die Deutsche Reichsverfassung, 356, gehört die Propstei von Sint-Servaas in Maastricht nur dem Reichskanzler 'nach einer freilich falschen Urkunde', nämlich dieser Urkunde. Die Verleihung beruhe auf Gewohnheitsrecht. Auch Ficker, Vom Reichsfürstenstande, 363, Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 453, und Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches, 159, sprechen von einem Pseudo-Original, haben aber keine Bedenken gegen die Echtheit des Inhalts. Ficker weist darauf hin, dass das Sint-Servaaskapitel kaiserlich war, wie eine von Heinrich V. 1109 auf Intervention des Propstes, des Reichskanzlers Adelbert, getroffene Vereinbarung beweist (siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 3).
Nelis, "Examination", 9, stellt fest, dass "paléographiquement parlant, le diplȏme a l'aspect des plus bizarres". Er weist darauf hin, dass die Signumzeile und das Monogramm nicht von derselben Hand wie der Rest der Urkunde geschrieben wurden. Außerdem ist der Abstand zwischen der vorletzten Zeile des Urkundentextes und der Signumzeile außergewöhnlich gering, was bei Urkunden, die von der kaiserlichen Kanzlei stammen, selten ist. Dies und die Tatsache, dass die Signumzeile und das Monogramm von einer anderen Hand stammen, lässt ihn vermuten, dass es sich bei der vorliegenden Urkunde um ein Blankett handeln könnte. In diesem Fall wäre das Pergament bis auf die Signumzeile und das Monogramm leer, wurde von Kaiser Heinrich IV. übergeben, woraufhin der Destinataris, das Maastrichter Sint-Servaaskapitel, den Urkundentext geschrieben hätte. Er weist auch auf das Fehlen des Chrismons hin. Nach seiner Meinung ist die oblongierte Invocatio das Werk eines unerfahrenen Notars in der Kanzlei oder eines Skribenten außerhalb. Auch die wackelige Schrift der invocatio deutet auf einen Schreiber hin, der mit dieser Art von Schrift nicht vertraut war, die paläographisch nicht mit den Skriptorien der deutschen Könige und Kaiser in Verbindung gebracht werden kann. Er datiert beide Schreibhände in das späte 11. und frühe 12. Jahrhundert.
Nelis weist darauf hin, dass die abschließenden Worte "G. filius eius cum multis aliis" nicht das ursprüngliche Ende des Textes gewesen sein können, wenn man bedenkt, dass danach und darunter eine radierte Stelle folgt. Bei seinen Experimenten mit einem chemischen Präparat wurde eine weitere (unleserliche) Textzeile auf der Höhe der Rasur entdeckt. Er vermutet, dass die radierten Worte Teil der oblongierten Unterschrift des Kanzlers gewesen sein müssen, und zweifelt nicht daran, dass diese "Hermannus, cancellarius vice Wezelonis, archicancellarii, recognovi" lauten muss. Für die Transkription von "Hermannus" stützt er sich auf die Ausgabe von De Borman, "Notice", 14-15, der eine weitere Urkunde von 1087, die Echt betrifft, nach einem in Paris aufbewahrten Kartular van Sint-Servaas (Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 9307/2) ausgestellt hat. Diesem Kartular zufolge lautet die Schreibweise jedoch "Herimannus", wie sie in den Originalurkunden Heinrichs IV. üblich ist (siehe Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-2).
Was das Siegel betrifft, so stellt er einen unförmigen Rest fest, der ungeschickt restauriert wurde und in der Größe nicht mit dem Siegel Kaiser Heinrichs IV. übereinstimmt. Seiner Meinung nach hätte es doppelt so groß sein müssen und einen Teil des Wortes "imperatoris" in der Signumzeile verdecken müssen. Daraus folgert er, dass das Siegel mit Sicherheit erst nach der Niederschrift dieser Zeile angebracht wurde.
Gysseling und Koch, Diplomata Belgica I, 384-385, stellen die Echtheit der vorliegenden Urkunde ebenfalls in Frage, begründen ihre Zweifel aber nicht. Sie stufen sie als eine mögliche gleichzeitige Fälschung ein.
Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-2, 522, hält die Urkunde aufgrund der Schrift für ein Falsum und datiert ihre Herstellung auf den Beginn des zwölften Jahrhunderts. Er verweist auf die bereits vor der scriptio vorhandenen Falten des Pergaments, um die herum geschrieben wurde, sowie auf die hellere Tinte, mit der die Signumzeile und das Monogramm aufgetragen wurden. Ohne weitere Argumentation widerspricht er jedoch Nelis, dass es sich hier um ein Blankett handeln würde, die mit einem echten Siegel und einer von der Kanzlei angebrachten Signumzeile versehen war. Diese Möglichkeit wird auch von Deeters, Servatiusstift, 41-42, aus inhaltlichen Gründen abgelehnt. Zum Siegel bemerkt Gladiss "das Siegel ist roh gearbeitet und unecht", eine Beobachtung, die auch von Deeters übernommen wird. Die von Gladiss abgelehnte Frühdatierung des Falsums durch Gysseling und Koch wird auch von Deeters nicht aufgegriffen. Schließlich datiert Hübinger, "Libertas imperii", 93, die Abfassung des Falsums in das zwölfte Jahrhundert.
Nach Nelis, o.c., 14-17, unterscheidet sich das Diktat in der vorliegenden Urkunde wesentlich von denen des Kanzleramtes. Dies betrifft die invocatio, intitulatio, arenga, die Stelle der datatio und das Fehlen der subscriptio durch den Kanzler. Er fand jedoch eine Diktatverwandtschaft mit der in Abschrift überlieferten Urkunde von 1087, in der Heinrich IV. die Rückgabe der Kirche von Echt an das Kapitel von Sint-Servaas bestätigt (in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits Nr. 9307/2; für eine Ausgabe siehe Gladiss, o.c., 521-522, Nr. 394).
Auch Gladiss, o.c., 522, identifiziert die erwähnten Diktatentlehnungen durch den von Nelis erwähnten Fälscher. In seiner Edition der Urkunde Heinrichs IV. von 1087 über Echt führt er aus, dass auch diese Vorlage eine Reihe von Unregelmäßigkeiten enthält, sieht darin aber keinen Grund, sie als falsum zu bezeichnen. Seiner Meinung nach muss die Urkunde ohne die Beteiligung der Reichskanzlei entstanden sein. Was die vorliegende Urkunde anbelangt, so geht er davon aus, dass ihre Entstehung allenfalls eine Situation konsolidierte, in der die Propstei von Sint-Servaas mit dem Amt der deutschen Kanzler verbunden war, wobei der erste Adelbert unter Heinrich V. um 1109 war.
Deeters, o.c., 41-42, der Nelis und Gladiss folgt, identifiziert die Diktatverwandtschaft mit der Urkunde von 1087 über Echt. Er meintt auch, dass angesichts der radierten Stellen das Pergament der Urkunde für Echt für die vorliegende Urkunde verwendet worden sein könnte. Dies kann radierten Stellen nicht den gesamten Urkundentext betreffen, sondern nur beiläufige Worte, abgesehen von den umfangreichen Radierungen, die auf und unter der Signumzeile stehen.
Wie auch andere Autoren zweifelt auch Nelis nicht an der Echtheit des Inhalts. Die vorliegende Charta verkündet die kaiserliche Autorität, begründet die geistliche und weltliche Unabhängigkeit des Kapitels und schließt die Ansprüche lästiger Vögte aus. All dies sei vor dem Hintergrund der seit der Mitte des 11. Jahrhunderts andauernden und langwierigen Konflikte zwischen dem Kapitel und mehreren Parteien zu sehen, wie z. B. mit einem wohlhabenden Kölner Bürger, einem Pfalzgrafen, einem Herzog von Brabant, einem Grafen von Namen, einem Grafen von Wassenberg und einem Bischof von Utrecht. Der Konflikt mit dem Grafen von Wassenberg wurde erst durch das Eingreifen von Kaiser Lothar III. im Jahr 1128 beigelegt.
Die Klausel über den Propstei spricht - laut Nelis - für eine inhaltliche Authentizität. Die Zuweisung der Propstei von Sint-Servaas an den Kanzler des Römischen Reiches, also nicht an das Sint-Servaaskapitel selbst, wird nicht aus dem Kapitel heraus initiiert worden sein. Außerdem kann diese Klausel nicht als anachronistisch bezeichnet werden, da die Kumulation der Kanzlerschaft mit der Verwaltung der Propsteien anderer Kapitel ab dem 11. Jahrhundert sehr üblich ist. Die Begründung der Unabhängigkeit hinsichtlich jeder weltlichen Macht außer der des Kaisers erklärt sich - nach Nelis - aus dem problematischen Verhältnis zum Erzbischof von Trier am Ende des 11. Jahrhunderts. Er sieht in der Urkunde von 1087 ein Echo der in den erzählenden Quellen zum Ausdruck kommenden Stimmung gegen Trier als älteste Kirche des Deutschen Reiches. Eine Rückkehr zu der Situation, in der die Sint-Servaaskirche zu Trier gehörte, sollte unter allen Umständen vermieden werden (zur Schenkung an Trier und zu den Verwicklungen zwischen ost- und westfränkischen Königen und den Trierer Erzbischöfen siehe Hackeng, o.c., 37-38).
Schließlich kommt Nelis, o.c., 32, zu dem Schluss, dass das Sint-Servaaskapitel um 1087 oder im selben Jahr von Kaiser Heinrich IV. zu einem mehrfachen Zweck begünstigt wurde: um seine Unabhängigkeit von Trier festzustellen, um die Proklamation als kaiserliches Kapitel herbeizuführen, um die Propstei von Maastricht mit der Reichskanzlei zu vereinen und um das Kapitel vor den Übergriffen der Laienvögte zu schützen. Nach Nelis wurde die vorliegende Urkunde nicht von der Reichskanzlei ausgestellt, sondern die scriptio wurde dem Kapitel überlassen, das ein Blankett mit der subscriptio, dem Monogramm und dem Siegel Heinrichs IV. erhielt. Auch wenn das Diktat von den üblichen Kanzleivorschriften abweiche, spiegele es die Intentionen des Kanzlers wider und widerspreche nicht dem Ablauf der Ereignisse im frühen 12. Jahrhundert. Nelis datiert die Herstellung des Falsums auf das Ende des 11. und das erste Viertel des 12. Jahrhunderts.
Deeters, a.a.O., 59-60, legt in seiner Argumentation einen starken Akzent auf die Textstelle über die Zuordnung des Propstei zum Kanzler und die damit verbundene Vogteiausübung, was in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts tatsächlich der Fall war. Konkret führt ihn dies zu der Herstellung des Falsums unter dem Propst Gerard van Are (1154-1160). In dieser Zeit stand die Ämtergemeinschaft unter Druck, denn Gerard van Are war lange Zeit der erste Propst, der die Propstei nicht durch seine Verbindung zur deutschen Hofkapelle oder Kanzlei erworben hatte. Sein Nachfolger, Christiaan von Buch, der 1164-1165 als Propst des Sint-Servaaskapitels bekannt war, vereinte dagegen seit 1162 wieder beide Ämter. Unseres Erachtens ist es jedoch höchst zweifelhaft, ob diese vorübergehende Unterbrechung der Aufgabenwahrnehmung beim Sint-Servaaskapitel die Notwendigkeit einer kaiserlichen Urkunde nach sich gezogen hätte. Die älteste Erwähnung des Sint- Servaaskapitels als kaiserliches Kapitel finden wir übrigens bereits in einer Urkunde Kaiser Lothars III. aus dem Jahr 1132 (siehe die Ausgabe in Ottenthal und Hirsch, Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza, 66-68, Nr. 41), die eine Proklamation als kaiserliches Kapitel vor 1154-1160 adstruiert. Das von ihm vorgeschlagene Entstehungsdatum des Falsums in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts muss unserer Meinung nach abgelehnt werden.
Auch der Ansicht von Linssen, Historische opstellen, 130ff, hinsichtlich des Entstehungsdatums des Falsums kann nicht gefolgt werden. Er ignoriert das Argument von Nelis völlig und wundert sich darüber, dass die Urkunde, wenn sie im frühen 12. Jahrhundert erstellt worden wäre, wie Gladiss vermutet, nicht früher als erst 1232 erwähnt wird. Es habe - seiner Meinung nach - mehrere Anlässe gegeben, um die Charta als Beweismittel einzusetzeni, sagt er. Damit bezieht er sich auf den eindeutigen Nachweis der Reichsimmunität und der Immunitätsrechte, die in der Charta von 1087 festgelegt sind. Aufgrund ihres Inhalts datiert er die Erstellung der Urkunde nur auf die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts. Ihm zufolge steht die Urkunde der Vergabe eines Lehens entgegen, was nicht im 11. Jahrhundert, sondern erst 1204 geschah. Damals belehnte König Philipp von Schwaben den Herzog von Brabant mit Maastricht, der Sint-Servaaskirche und allem, was dazu gehörte. Er verweist auch auf den Zeitpunkt im Jahr 1214, als der Herzog von Brabant nach einer bewegten Zeit Maastricht als Lehen zurückerhielt und erbte. Unserer Meinung nach kann dies jedoch in dem Kapitel keine Rolle gespielt haben, da die Sint-Servaaskirche nicht dazu gehörte (siehe Hackeng, o.c., 86). Nach Linssen passt die Formulierung, wonach alle königlichen Rechte vom Papst und dem Heiligen Stuhl abhängen, in die kurze Zeit nach dem Frieden von San Germano und Ceprano, der am 23. Juni 1230 geschlossen wurde. Als Erklärung dafür, dass das Falsum von 1087 offensichtlich nicht von einer Schreibhand des dreizehnten Jahrhunderts verfasst wurde, beruft er sich auf eine viel spätere "Antiquisierung". Dies erscheint uns aus paläographischen Gründen nicht plausibel. Anknüpfend an Linssens Argumentation hält Hackeng, o.c., 311, die vorliegende Urkunde für ein Falsum aus der Mitte des zwölften/ersten Viertels des dreizehnten Jahrhunderts.
Mehrere Autoren haben zu Recht Vorbehalte gegen eine Reihe äußerer Merkmale der vorliegenden Urkunde geäußert, doch spricht nichts gegen eine inhaltliche Datierung in das Jahr 1087. Selbst im Falle einer Destinatarisierung bleiben die Befestigung des Siegels ganz rechts auf dem Pergament, die Stelle der Signumzeile und die radierte Zeile neben und unter den letzten Worten des Urkundentextes problematisch. Die Stelle des Siegels bleibt merkwürdig, aber Nelis' fester Überzeugung, dass der Rest nicht der Größe des Siegels Kaiser Heinrichs IV. entspricht, kann nicht zugestimmt werden. Erstens wurde laut Venner, "Zegelsl", Nr. 41, um 1972 bereits festgestellt, dass die Siegelfragmente in der Vergangenheit falsch zusammengefügt wurden. Außerdem wurde der schlechte Zustand des Siegels bereits im siebzehnten Jahrhundert festgestellt, wie eine beglaubigte Kopie vom 28. Mai 1668 belegt: "et erat subimpressum sigillum ex parte confractum pre vetustate" (siehe Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 12, fol. 34). Es kann auch argumentiert werden, dass auf dem Pergament ein Platz von 8 cm Durchmesser für das Siegel vorgesehen war. Die Größe des Rundsiegels Heinrichs IV. an einer Urkunde von 1062 beträgt 6,8 cm im Durchmesser ohne Rand (Karlsruhe, Generallandesarchiv, Signatur A 97). Es war also viel Platz für das Siegel des Königs. Das kreisrunde Reichssiegel auf einer Urkunde aus dem Jahr 1102 hat ohne Rand einen Durchmesser von 9 cm (Ibidem, Signatur A 116). Damit würde das Siegel einen kleinen Teil des Urkundentextes verdecken. Bei diesem minimalen Unterschied ist zu berücksichtigen, dass auch mehrere Urkunden bekannt sind, bei denen sich ein Teil des Urkundentextes unter dem aufgedruckten Siegel befindet. Zum Beispiel in einer Urkunde von Otbert, Bischof von Lüttich, datiert 1096 (Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B001, archief kapittel van Onze Lieve Vrouw in Maastricht, 1096-1796, Inv. Nr. 640), von Friedrich II, Erzbischof von Köln, d.d. [25. Dezember 1157-] 1158[15. Dezember] (Ibidem, Zugang Nr 14.D004, archief Abdij Kloosterrade, Inv. Nr. 802,2), von der Magistra der der Sankt-Mauritiuskirche in Köln aus dem Jahr 1158 (Ibidem, Zugang Nr. 14.B001, archief kapittel van Onze Lieve Vrouw in Maastricht, 1096-1796, Inv. Nr. 633) und von der Äbtissin von Thorn aus dem Jahr (1171 Dezember 25 -) 1172 (September 23) (Ibidem, Zugang Nr. 01.187A, archief Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv. Nr. 6). Es ist also nicht auszuschließen, dass die vorliegende Urkunde doch mit dem kaiserlichen Siegel Heinrichs IV. besiegelt wurde.
Eine stichhaltige Erklärung für den radierten Text bleibt schwierig, da die Ergebnisse von Nelis nicht mehr überprüfbar sind. Bei der Untersuchung des Pergaments mit einer Quarzlampe wurde keine Spur des radierten Textes gefunden. Ob sich die recognitio an dieser Stelle befand, bleibt daher ungewiss. Falls ja, könnte die Rasur auf eine recognitio hindeuten, die später notgedrungen entfernt wurde, etwa weil der Name des Kanzlers nicht (mehr) mit dem des Beamten zum Zeitpunkt der Validierung der Urkunde übereinstimmte. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der Text in einem frühen Stadium nach der scriptio gelöscht wurde, da er weder in der Urkunde Friedrichs II. von 1232 Dezember (siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 16) enthalten ist noch im Vidimus des Maastrichter Onze-Lieve-Vrouwkapitels aus dem zweiten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts (siehe Sammlung des St. Servaas-Kapitels, Nr. 18) und und in keiner der vom Original kopierten Abschriften in den Cartularia enthalten ist.
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, 460-462, und Gladiss und Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-1, XLIII-XLV, weisen darauf hin, dass die Destinatare in dieser Zeit oft einen großen Anteil an der Ausstellung der königlichen und kaiserlichen Urkunden hatten, sowohl an der redactio als auch an der scriptio. Dabei gab es eine Reihe von Mischformen, bei denen der Destinatar den Kontext und Teile des Protokolls entweder nach einem Diktat des Destinatars selbst oder nach einem Diktat des Kanzlers abändern konnte, woraufhin die Kanzleischreiber lediglich die Bestätigungsformeln des Eschatokolls oder Teile davon hinzufügten. Eine weitergehende Form war die Aushändigung eines Blankett durch die Kanzlei an den Destinatar mit nur den Beglaubigungsformeln, wo der Empfänger dann den Text niederschreiben konnte, der darauf beim Siegeln überprüft wurde; oder man überließ die scriptio ganz dem Destinatar und fügte später nur das Siegel und das Monogramm hinzu.
Bei der Herstellung der vorliegenden Urkunde sind also viele Formen denkbar. Eine Kanzleifertigung kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden; die Schrift und das Diktat kann dem Empfänger, dem Maastrichter Sint-Servaaskapitel, zugeschrieben werden. Folgt man der Argumentation von Nelis in Bezug auf das Blankett, wonach die Kanzlei das ungeschriebene und gefaltete Pergament mit der Signumzeile und dem Monogramm an das Sint-Servaaskapitel übergeben hat, stellt sich immer noch die Frage, warum die Signumzeile auf halber Höhe des Pergaments, unmittelbar nach einer Rasur, geschrieben wurde. In Urkunden, die von den Kanzleien römischer Könige und Kaiser ausgestellt wurden, steht die Signumzeile nämlich nicht neben, sondern unter dem Urkundentext; auch bringt man das Siegel nie rechts oberhalb der Signumzeile an (vgl. http://www.hgw-online.net/abbildungsverzeichnis/deutschland/salier/heinrich-iv; Gladiss und Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-1, XCVI-XCVII). Im Übrigen wird das Siegel nicht angekündigt, was höchst ungewöhnlich ist.
Folgt man der Auffassung von Nelis bezüglich dedes Blanketts nicht, so kommt eine scriptio des Urkundentextes durch das Sint-Servaaskapitel in Frage, ohne die Signumzeilel, aber möglicherweise mit der recognitio, die später in der Kanzlei beim Siegeln und Schreiben der Signumzeile radiert worden sein könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass die oblongierte invocatio von der gleichen Hand wie der Urkundentext geschrieben wurde, auch wenn eine hellere Tinte verwendet wurde. Die Signumzeile wurde jedoch von einer anderen Hand hinzugefügt.
Die vorliegende Urkunde wurde im Jahr 1087 ausgestellt, in einer für die Kanzlei turbulenten Zeit. Am 4. Oktober 1084 wird zum ersten Mal seit 1077 wieder ein (deutscher) Erzkanzler erwähnt, nämlich Wezelo von Mainz (siehe Gladiss und Gawlik, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-1, XLI, und Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-2, Nr. 369). Diese Urkunde wurde von Kanzler Gebehard rekognosziert. Einen Monat später wurde eine kaiserliche Urkunde ohne Rekognition ausgestellt (Gladiss, o.c., Nr. 370), obwohl Gebehard erst am 26. Juni 1089 starb. Am 1. Juni 1085 scheint Heriman in zwei falsa (Gladiss, a.a.O., Nr. 373 und 374) zum ersten Mal als sein Nachfolger erwähnt worden zu sein. In einer unverdächtigen Urkunde vom 9. November 1085 wird Burchard, Kanzler der italienischen Kanzlei, erwähnt (Gladiss, a.a.O., Nr. 376), und erst am 28. Dezember 1085 finden wir die erste Erwähnung des Kanzlers Heriman in einer unverdächtigen Urkunde (Gladiss, a.a.O., Nr. 377). Seine letzte Rekognition datiert vom 5. April 1089 (Gladiss, o.c., Nr. 405). Geht man von einer Erstellung der vorliegenden Urkunde im Jahr 1087 aus, so ist die Beobachtung von Gladiss, a.a.O., 524-525, Nr. 396, bei einer kaiserlichen Urkunde desselben Jahres zu beachten: "In der Datierung findet sich kein Anhaltspunkt einer Beteiligung der Kanzlei; doch scheint damals überhaupt durch einen Wechsel der Notare deren regelmäßiger Geschaftsgang gestört gewesen zu sein". Ein nicht unbedeutendes Element angesichts der bemerkenswerten äußeren Merkmale der vorliegenden Charta. Abweichendee äußere Merkmale in dieser Zeit zeigen sich auch bei Gladiss, o.c., 502-503, Nr. 377, datiert auf den 28. Dezember 1085, wo das labarum vor dem chrismon steht und die recognitio rechts oberhalb der kaiserlichen subscriptio steht. Auch diese Urkunde wurde außerhalb der Kanzlei erstellt.
In Anbetracht dessen ist es durchaus denkbar, dass das Sint-Servaaskapitel den Urkundentext der vorliegenden Urkunde einschließlich der recognitio redigiert und verfasst hat, woraufhin sie der Reichskanzlei zur Besiegelung und Rekognition vorgelegt wurde. Die Unterbrechung des Ablaufs in der Kanzlei könnte dazu geführt haben, dass die Rekognition erst nach dem Tod des Kanzlers Heribert erfolgte, was die Radierung der recognitio und die seltsame Lage der Signumzeile erklären könnte. Dass diese Urkunde mit einem gefälschten Siegel Heinrichs IV. besiegelt wurde, wie Gladiss anmerkt und für ihn die Fälschung bestätigt, können wir nicht unterschreiben. Schließlich war das Siegel bereits im siebzehnten Jahrhundert stark beschädigt und zum Zeitpunkt seiner Forschung unwiderruflich fragmentarisch und falsch restauriert.
Obwohl diese Urkunde eine Reihe auffälliger äußerer und innerer Merkmale aufweist, scheint eine Fälschung hier nicht in Frage zu kommen. Bei der Urkunde handelt es sich zweifellos um die ErSte, was eine Reihe von Besonderheiten erklärt, und ihr Inhalt ist unbestritten. Nach Nelis scheint es sehr wahrscheinlich, dass das St. Servaas-Kapitel seine besondere Verbindung zu den deutschen Königen und Kaisern und damit seine einzigartige Stellung gegenüber anderen Herrschern durch ein schriftliches Dokument sichern wollte. En passant wurde auch die damals gängige Kombination von Kanzlerschaft und Proskription von St. Servatius festgelegt. Für das Diktat stützte sich das St. Servaas-Kapitel auf die Urkunde Heinrichs IV. über Echt, die heute nur noch in Abschrift erhalten ist, eine vom Kapitel ebenfalls 1087 erteilte Bestimmung.
Kohärenz
Für die Bestätigung der vorliegenden Urkunde durch Kaiser Friedrich II. vom Dezember 1232 und durch den römischen König Rudolf I. vom 5. November 1273, siehe , Nr. 16 und 37. Für die Bestätigung der Urkunde Friedrichs II. vom Dezember1232 , datiert auf den 9. April 1282, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel , Nr. 49. Für das Vidimus aus dem zweiten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts vom Onze-Lieve-Vrouwkapittel in Maastricht, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 18.
Textausgabe
In der vorliegenden Urkunde sind Teile des Textes aus der Urkunde Kaiser Heinrichs IV. aus de Jahre 1087 über die Kirche von Echt übernommen worden. Für den Text dieser Urkunde siehe Gladiss, Die Urkunden Heinrichs IV., VI-2, 521-522, Nr. 394. Für die Textteile, die aus dieser Vorurkunde stammen und in kleinerer Schrift gedruckt wurden, siehe Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 36-37.


Nummer 3
Jan Gruszere hat mit Zustimmung der Kirche Unserer-Lieben-Frau in Thorn ihre steuerpflichtigen Äcker in Houthem (in der Herrschaft Valkenburg) an das Kloster Sint-Gerlach in Houthem verkauft. Dies wurde von Rutger, dem Schulzen von Thorn, veranlasst. Dadurch erhielt die Jungfrau Clementia van Geilenkirchen, Nonne von Sint-Gerlach, diese Felder aus den Händen der Äbtissin und des Schulzen von Thorn. Die Kirche von Thorn erhält vom Kloster Sint-Gerlach die üblichen "cijns" (Zins oder Steuer) von diesen Feldern und von der toten Hand (Steuer bei Tod) nicht mehr als die doppelten "cijns". Sollte Clementia das Kloster Sint-Gerlach verlassen, um in ein Kloster mit einer strengeren Lebensregel einzutreten, oder wenn sie und ihre Mitschwestern an einen anderen Ort versetzt werden, um ein neues Kloster zu gründen, wird das Kloster Sint-Gerlach die tote Hand nicht zu diesem Zeitpunkt an die Abtei Thorn zahlen, sondern erst, nachdem ihr Tod anerkannt worden ist.
Es wird verkündet, daß Jan Gruszere mit dem Einverständnis der Kirche Unserer Lieben Frau von Thorn durch die Hand von Rutger, dem Schulzen von Thorn, dem Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) cijnspflichtige Äcker in Houthem in der Herrschaft Valkenburg verkauft hat und daß jonkvrouwe Clementia van Geilenkirchen, die dort
Nonne ist, diese aus den Händen der Äbtissin und des Schulzen von Thorn erhalten hat unter der Bedingung, daß das Kloster Sint-Gerlach bei ihrem Austritt, um ein neues Kloster zu gründen, die tote Hand erst an Thorn zahlen wird, wenn Thorn ihren Tod anerkannt hat.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 39, Reg. Nr. 12.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1° von der Hand des letzten Viertels des 14. Jahrhunderts: G j. - 2°von der Hand des 17. Jahrhunderts: 1232. - 3°von der Handdes 18. Jahrhunderts: Num. 77.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Hildegonde, Äbtissin von Thorn, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 156.
Abschriften
B. 1287 Aug. 9, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Freies Königreich Thorn, Inv. Nr. 69, von Willem, Probst von Sint-Gerlach in Houthem, an A. - C. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 1 (Kartular) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 123-124, unter der Rubrik: Renuntiatio ecclesie Thorensis de uno et viginti denariis Leodiensibus super agris in Houthem, und am Rande: Num. 77, unter Angabe einer Siegelstelle, an A.
Ausgabe
a. Franquinet, Aufgezeichnetes Inventar von St. Gerlach, IV, 6-7, Nr. 4, nach A (datiert 1232).
Zusammenfassungen
Habets, Archiv Thorn, 12, Nr. 12 (datiert 1232). - Haas, Inventar von St. Gerlach, 68-69, Reg. Nr. 4 (aus dem Jahr 1232). - Idem, Chronologische Liste, 41, Reg. Nr. 76 (datiert 1232).
Datierung
Es wird angenommen, daß die Bischöfe von Lüttich um 1230 vom Weihnachtsstil zum Osterstil übergingen und daß die religiösen Einrichtungen des Bistums erst einige Zeit später folgten, siehe Camps, ONB I, XXI. Für die Datierung der vorliegenden Urkunde wurde daher die Verwendung des Weihnachtsstils angenommen. Der terminus ante quem wird durch die fünfte Indiktion bestimmt, die durch die indictio Bedana am 24. September 1232 in Kraft tritt].

Nummer 3
Hilzondis, Gräfin van Strijen, läßt auf Anraten ihres Mannes Ansfried auf ihrem eigenen Gut Thorn eine Kirche errichten, in der sie und ihre Tochter Benedicta das klösterliche Leben führen werden. Sie schenkt dieser Kirche ihren eigenen Besitz im Lande Strijen, der einst von König Zwentibold geschenkt wurde, nämlich die Kirche von Strijen, den Geertruidenberg, die Villa Gilze mit Zubehör, die Villa Baarle mit dem von ihr gestifteten Remigius-Altar, die Burg Sprundelheim an der Merbatta und einen Wald, wie er zwischen den beiden Marken liegt.
<Hilzondis, gravin van Strijen, sticht op aanraden van haar echtgenoot Ansfried een kloosterkerk op haar eigen goed Thorn, waar zij en haar dochter Benedicta het kloosterleven zullen leiden, en schenkt aan het klooster geheel haar eigen goed in het land van Strijen, dat eertijds door koning Zwentibold was geschonken, bestaande uit de kerk van Strijen, Geertruidenberg, de villa Gilze met toebehoren, de villa Baarle met het door haar, Hilzondis, gestichte Remigiusaltaar, het slot Sprundelheim aan de Merbatta, en een bos zoals het ligt tussen de twee Marcas.>
Scheinbares Original
[<A>]. Schijnorigineel of ontwerp hiervoor niet voorhanden, of hebben mogelijk niet bestaan.
Kopie
B. ca. 1640, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, C (ehemals Brüssel, ARA, Kirchliches Archiv von Brabant), Präliminarien Inv. Nr. 19231/37 = lose Urkunde, in dorso: Fundatio in (sic) Thorn, einfache Abschrift, direkt oder indirekt nach einem verlorenen Register, zusammengestellt von Michiel Piggen, Schreiber des Rates und Rechnungshofes in Breda, zusammengestellt ca. 1545-ca. 1610, möglicherweise ca. 1565-1587.
Ausgabe
a. Dillo-Van Synghel, ONB II, 16-29, Nr. 892.
Textausgabe
Im Oorkondenboek van Noord-Brabant wird von diesem Falsum keine einzige rekonstruierte Urkunde veröffentlicht, sondern die beiden Hauptüberlieferungen werden in zwei Spalten dargestellt. Die älteste Überlieferung in der linken Spalte ist die Übersetzung, die den besten Text darstellt.


Nummer 3
Friedrich I., Erzbischof von Köln, schenkt der Abtei Kloosterrade die Zehnten ihrer mit Weinbergen bepflanzten Urbarmachungen in Ahrweiler.
Friedrich I., Erzbischof von Köln, schenkt der Abtei Kloosterrade die Zehnten ihrer mit Weinbergen bepflanzten Urbarmachungen in Ahrweiler.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 763.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 12-14, Nr. 3, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 4
Papst Gregor IX. schützt das Kloster Unserer-Lieben-Frau Sint-Gerlach in Houthem und die dort lebenden Nonnen und bestätigt das Kloster in allen seinen gegenwärtigen und zukünftigen Besitztümern.
Papst Gregor IX. nimmt das Kloster Unserer Lieben Frau Sint-Gerlach (in Houthem) in Schutz und bestätigt es in allen gegenwärtigen und zukünftigen Besitztümern.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Sint-Gerlach Kloster in Houthem, Inv.-Nr. 3, Reg.-Nr. 5. Liniert. Beschädigt mit Verlust von Text.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von der Hand aus dem letzten Vierteldes 14. Jahrhunderts: A j. - 2o von der Hand des 15. Jahrhunderts: Bos. - 3°von der Handdes 17. Jahrhunderts: Confirmatio possessionum bonorum et potestas a[***]. - 4°von einer Hand ausdem 18. Jahrhundert: Num. 68.
Versiegelung: keine Spuren einer Versiegelung durch Wegschneiden der Unterseite des Pergaments.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 112-113, unter der Überschrift: Bulla Gregorii, pape, exemptionis monasterii sancti Gerlaci et eiusdem bonorum, und am Rande: Num. 68, unter Angabe einer Siegelstelle, zu A.
Ausgaben
a. Franquinet, aufgezeichnetets Inventar Sint-Gerlach, IV, 7-8, Nr. 5, nach A. - b. Habets, 'Houthem-Sint-Gerlach', 219-220, Nr. 14 (fälschlicherweise datiert 1376 Januar 10), nach B.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 69, Reg.-Nr. 5. - Idem, Chronologische Liste, 41, Reg.-Nr. 77.


Nummer 4
Der römische König Heinrich II. verleiht der Abtei Thorn das Markt- und Zollrecht sowie die Gerichtsbarkeit in Thorn. Er ratifiziert auch die Übertragung der Kirchen von Bree, Hemert und Avezaath durch Bischof Notger an die Abtei.
Der römische König Heinrich II. verleiht der Abtei Thorn das Marktrecht, die Zölle und die Gerichtsbarkeit in Thorn und bestätigt die Schenkung der Kirchen von Bree, Hemert und Avezaath an die Abtei durch Bischof Notger von Lüttich.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 4.
Ausgabe
a. Muller und Bouman,OSU I, 154-155, Nr. 163, nach A.


Nummer 4
Adelbero II., Bischof von Lüttich, beurkundet, dass Rudolf de Turri, Ministeriale des Grafen Adolf van Saffenberg, mit Zustimmung seiner Frau Waldrade und seiner Söhne Paganus, Gevehard und Herman durch seinen Herrn, den Vormund der Abtei Kloosterrade, seinen Besitz in Hubach, auf dem ein Frauenkloster (Marienthal) errichtet wurde, der Abtei geschenkt hat, und regelt das Verhältnis zwischen der Abtei und dem Tochterkloster.
Adelbero II., Bischof von Lüttich, beurkundet, dass Rudolf de Turri, Ministeriale des Grafen Adolf van Saffenberg, mit Zustimmung seiner Frau Waldrade und seiner Söhne Paganus, Gevehard und Herman, durch seinen Herrn, den Vormund der Abtei Kloosterrade, seinen Besitz in Hubach, auf dem ein Frauenkloster (Marienthal) errichtet wurde, der Abtei geschenkt hat, und regelt das Verhältnis zwischen der Abtei und dem Tochterkloster.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 676.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 15-19, Nr. 5, nach A.
Authentizität
Zur möglichen Unechtheit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 3
Der römische König Heinrich V. erneuert und bestätigt auf Vermittlung von Adelbert, seinem Kanzler und Propst der Sint-Servaaskirche in Maastricht und auf die Bitte der Kanoniker,die zuvor aufgeschriebenen Rechtsregeln sowie den Austausch von zwei Höfen in Maastricht, die der von seinem Vater, Kaiser Heinrich IV. um 1076 gemacht wurden.
Der römische König Heinrich V. erneuert und bestätigt auf Vermittlung von Adelbert, seinem Kanzler und Propst der Sint-Servaaskirche in Maastricht und auf die Bitte der Kanoniker,die zuvor aufgeschriebenen Rechtsregeln sowie den Austausch von zwei Höfen in Maastricht, die der von seinem Vater, Kaiser Heinrich IV. um 1076 gemacht wurden.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas von Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 43. Beschädigt mit Verlust von Text.
Siegel: ein aufprägtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 des römischen Königs Heinrich V., aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Zegels", Nr. 42.
Abschriften
[B]. 1218 Juni 10, nicht vorhanden, aber bekannt aus C, Vidimus von Otto von Everstein, Propst des Sint-Servaaskapitelsin Maastricht, nach A. - C. 22. September 1268, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 48, Vidimus vom römischen König Richard von Cornwall, nach A. - Jh., Ibidem, idem, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 13v-14r (= neue fol. 30v-31r), Nr. 25, nach A. - E. 15. Jh., Ibidem, Zugang Nr. 14.B001, archief kapittel van Onze Lieve Vrouw in Maastricht, 1096-1796, Inv. Nr. 31 (cartularium), fol. 181r-182r, unter der Überschrift: Item tenores omnium et singulorum exhiborum sequuntur per ordinem in hunc modum et sunt tales, und unter caput: Item tenores litterarum imperialium felicis recordationis domini Heynrici, Romanorum regis quinti, sigillo quondam confundo et leso in quo ymago imperatoris in dextera ceptrum regale, in sinistra vero pommum imperiale cum cruce superposita gestantur, sana et integra habebantur in margine inferiori ipsarum litterarum affixo sigillatarum et bullatarum atque signo quodam quadrato lineationibus et pluribus caracteribus composito dulsis etiam subtus caracteribus expressis signatarum sequuntur et sunt tales, nach A. - F. 1640, Ibidem, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 1741 (Kartular) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 14-16, unter der Überschrift: 10, Privilegium Henrici imperatoris pro immunitate officiatorum, an A. - G. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartular) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, S. 109-111, unter der Überschrift: Diploma Henrici quinti, Romanorum regis, quo declarat prepositam, decanum et capitulum omnes habere iurisdictiones, seclusis omnibus presentibus iudicibus, tam in eorum domibus claustris viis quam in templo et atriis, et quo modo hi eorum iurisdictiones exercere debeant, datum indictione secunda anni 1108 (korrigiert von 1109), beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, an A. - H. vor 1768, Ibidem, idem, S. 245-247, unter der Überschrift: Otto, prepositus Aquensis, declarat se vidisse integras et non cancellatas litteras Henrici quarti, Romanorum regis, quibus dat ministris ecclesie Sancti Servatii exemptionem et immunitatem, videlicet coco, pistori, bracedario et campanariis, in octavis Pentecostes 1218, an [B].
Ausgaben
a. Böhmer, Acta imperii selecta, 69-71, Nr. 75 (siehe auch dort für ältere Ausgaben), nach A. - b. Waitz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 18-25, Nr. 8, nach a. - c. Van de Kieft, 'Recueil', 427-429, Nr. 17 (unvollständig), nach A. - d. Thiel, Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, Nr. 283, nach b. - e. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 310-311, Nr. 96b (unvollständig), nach d.
Zusammenfassungen
Siehe Ausgabe a, sowie DiBe ID 6930.
Lokalisierung
Zur Lokalisierung der beiden Höfe in Maastricht siehe Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 210-211, sowie 719, Karte 31.
Authentizität und Entstehungsgeschichte
Böhmer, Acta imperii selecta, 70-71, disqualifiziert die vorliegende Urkunde aufgrund einer Reihe äußerer Merkmale, ohne sie ausdrücklich als falsum zu bezeichnen. Ihm zufolge fällt auf, dass der Text um die von oben nach unten verlaufenden Falten herum geschrieben ist, wie bei den Urkunden von Sint-Servaas vom 21. September 1062 und von 1087 (siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 1 und 2). Er weist auch auf die Leerstellen nach "Data" und "Actum" hin, nach denen das Datum und der Ortsname fehlen, sowie auf das fehlende "Amen".
Niermeyer, Untersuchungen, 172-179, bezeichnet diese Urkunde im Anschluss an Böhmer als Scheinoriginal. Er verweist u.a. auf die ungewöhnliche Größe des Perkaments, das etwa anderthalb mal so breit wie hoch ist, die merkwürdige Position der Signum- und Rekognitionszeilen zueinander, die Aussparung der letzten drei Zeilen des Kontextes zugunsten des ganz rechts angebrachten Siegels und den unverhältnismäßig großen Freiraum nach "Datum" und "Actum", wo die entsprechenden Angaben fehlen.
Niermeyer, a.a.O., 200 und 223, behauptet, dass die vorliegende Urkunde von der Person geschrieben wurde, die auch die seiner Meinung nach gefälschte Urkunde von 1062 verfasst hat. Paläographische Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass von einer Ähnlichkeit keine Rede sein kann (siehe auch Nr. 1 oben). Er argumentiert ferner, dass diese Schreibhand auch die beiden päpstlichen Falsa für das Erzbistum Hamburg von 885 und 912/913 geprägt hat (für eine Edition siehe Curschmann, Die älteren Papsturkunden, 29-30, Nr. 8 und 36-37, Nr. 13; speziell zur Schreibgruppe, zu der diese Falsa gehören, siehe Curschmann, o.c, 124-126) und dass diese Schreibhand einige Merkmale aufweist, die auf eine von Hand L geschriebene Urkunde des Bischofs von Lüttich zurückgehen (zu Hand L siehe Niermeyer, a.a.O., 188). Was Niermeyers Identifizierung betrifft ist jedoch Vorsicht geboten, wie auch aus seinen Beobachtungen bezüglich der 1151 von Hand O für Kloosterrade geschriebenen Bischofsurkunde hervorgeht (siehe Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 61). Sein Hinweis auf die bemerkenswerten Merkmale in der Mettage mit Text, der um die von oben nach unten verlaufenden Falten geschrieben wurde, sowohl in der vorliegenden Urkunde von 1109 als auch in den beiden päpstlichen Falsa für Hamburg ist jedoch gerechtfertigt.
Auf der Grundlage paläographischer Untersuchungen anhand eines Bildes dieser päpstlichen Urkunden kann vorläufig festgestellt werden, dass der Skriptor der vorliegenden Urkunde höchstwahrscheinlich mit dem der beiden päpstlichen Falsa identisch ist. Weitere Forschungen in Hannover zur Identifizierung der Hand durch Messungen von Neigungswinkeln, Schreibwinkeln usw. sind jedoch wünschenswert.
Bezüglich des Siegels führt Niermeyer unter Berufung auf Posse, Siegel Kaiser 1, Tabelle 19, 1, dass dieses nicht mit dem echten Königssiegel Heinrichs V. übereinstimme. Tatsächlich weist das Siegel der vorliegenden Urkunde auf dem Thron auf beiden Seiten die rollenförmigen Enden eines Kissens auf, das möglicherweise in zwei Tierköpfen endet. Diese Elemente, die auf den beiden kaiserlichen Siegeln Heinrichs V. zu finden sind, fehlen jedoch auf dem Siegel des echten Königssiegels. Aufgrund dieses abweichenden Siegelbildes kommt Niermeyer zu dem Schluss, dass das Siegel der vorliegenden Urkunde gefälscht ist und vermutlich ein Reichssiegel Heinrichs V. imitiert hat. Seine Befunde sind aufgrund des heutigen fragmentarischen Zustands des Siegels nicht mehr überprüfbar.
Bezüglich des Diktats signalisiert Niermeyer, o.c., 180-181, folgendes: 1. einen engen Diktatbezug zu einer Urkunde Heinrichs V. für Lüttich vom 23. Dezember 1107 (= Stumpf-Brentano, o.c., Nr. 3021; zur Edition siehe Waitz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 18-25, Nr. 7); 2. die Ableitung der Passage über die Intervention des Propstes desSint-Servaaskapitels aus einer um 1109 in Abschrift überlieferten Urkunde Heinrichs V. für das Sint-Servaaskapitel (= Stumpf-Brentano, a.a.O., Nr. 3215; zur Edition siehe Thiel, Die Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, Nr. 41); 3. eine abweichende corroboratio und die fehlende Zeugenliste im Vergleich zur Urkunde Heinrichs V. vom 23. Dezember 1107, aber Übereinstimmung in der corroboratio mit dem Wortlaut, der in der Kanzlei Heinrichs IV. üblich war, und zwar in einer Urkunde Heinrichs IV. für das Bistum Halberstadt vom 20. August 1063 August 20 (= Stumpf-Brentano, a.a.O, Nr. 2628; für eine Edition siehe Böhmer, Acta imperii selecta, 59, Nr. 61) und einer seiner Meinung nach gefälschten Urkunde von 1062 (siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 1).
Die Urkunde vom 23. Dezember 23 1107 diente zweifellos als Vorurkunde für die Redactio der vorliegenden Urkunde. Die Entlehnung der Textstelle über die Intervention des Propstes ist jedoch nicht spezifisch für die Urkunde von ca. 1109, sondern kommt auch schon in einer Urkunde Heinrichs V. vom 14. Februar 1106 vor (für eine Edition siehe Böhmer, Acta imperii selecta, 67-68, Nr. 72), wobei die Wortwahl "interventu" noch enger verwandt ist als in der Urkunde von 1107 mit "peticione". Die corroboratio bezieht sich auf den in der dispositio erwähnten Austausch der beiden Höfe, der von Heinrich IV. um 1076 vorgenommen wurde. Tatsächlich unterscheidet sich diese corroboratio von der in den Urkunden Heinrichs V. und ähnelt stark den Worten in den Urkunden Heinrichs IV., insbesondere der Urkunde von 1062.
Niermeyer kommt zu dem Schluss, dass sich das Falsum von 1109 "in unmittelbarer Abhängigkeit" von der Urkunde für Lüttich von 1107 zeigt, die erweitert und modifiziert wurde. Dabei diente die Urkunde vom 23. Dezember 1107, die nur durch Abschriften in einer interpolierten Fassung (vor allem in den Artikeln 3 und 5) überliefert ist, als Grundlage für die hiervorliegende Urkunde von 1109, vgl. Niermeyer, o.c., 162-165. In seiner abschließenden Schlussfolgerung stellt er die These auf, dass das falsum von 1109 zu einer Gruppe von Maastrichter falsa gehört, die nach 1146 und vermutlich um 1160 entstanden sind.
Van de Kieft, "Recueil", 427-429, schließt sich der Auffassung Niermeyers in Bezug auf die vorliegende Urkunde an. Nach Hausmann, Reichskanzlei, 17, Anm. 4, ist die Urkunde von 1109 ein Falsum aus dem späteren zwölften Jahrhundert. Nach seiner Meinung wurde die Urkunde auch nicht von einem der Notarii Heinrichs V. redigiert und/oder verfasst (tatsächlich fehlt sie in Hausmanns Liste, o.c., 64-67, mit den Notarii, die unter Adelbert von Saarbrücken, Kanzler des römischen Königs Heinrich V., für die Schrift, das Diktat oder für beides verantwortlich waren).
Deeters, Servatiusstift, 56 und 61-62, datiert die Entstehung der vorliegenden Urkunde in das frühe zwölfte Jahrhundert und folgt Niermeyer hinsichtlich der Diktatentlehnungen an die oben erwähnte Urkunde für Lüttich vom 23. Dezember 1107. Seiner Ansicht nach gibt es in der Urkunde von 1109 keine inhaltlichen Anhaltspunkte für eine Datierung der Fälschung. Obwohl er die Urkunde für eine formale Fälschung hält, entspricht der Inhalt seiner Meinung nach einer bestehenden Rechtslage.
Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 310, bezeichnet die vorliegende Urkunde unter Berufung auf Niermeyer, Van de Kieft und Böhmer als Falsum. Unter Berufung auf Deeters datiert er ihre Entstehung auf das 12. Jahrhundert, spätestens auf 1204.
Unserer Meinung nach wurde die vorliegende Charta nicht in der Kanzlei Heinrichs V. redigiert und/oder verfasst, sondern ist eine Destinatarisierung durch das Sint-Servaaskapitel in Maastricht auf der Grundlage der Charta des römischen Königs Heinrich V. vom 23. Dezember 1107 für die Kanoniker in Lüttich. Die von der Vorlage abweichende corroboratio in der vorliegenden Charta, die im Gegenteil eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Destinatarurkunde des Sint-Servaaskapitels von 1062 aufweist, deutet ebenfalls auf ein Entstehungsumfeld innerhalb des Kapitels hin. Eine Reihe von äußeren Merkmalen der vorliegenden Charta sind eigenartig, aber nicht ausschlaggebend, um diese Charta als Falsum zu bezeichnen. Die ungewöhnliche Position der Signumzeile auf halber Höhe des Pergaments kann möglicherweise auf den Destinatar zurückgeführt werden. Auch in der Urkunde Heinrichs IV. von 1087 (siehe Sammlung St. Servatius, Nr. 2), bei der es sich ebenfalls um eine Destinatar-Ausgabe handelt, befindet sich die Signumzeile auf halber Höhe der Schreiblinie. Dass das Siegel gefälscht wäre, wie Niermeyer vermutet, lässt sich aufgrund des schlechten Materialzustandes nicht nachweisen. Die abschließende Zeile in der datatio der vorliegenden Urkunde, "Data, actum feliciter in nomine Domini", ist genau dieselbe wie die abschließende Zeile in der Vorurkunde von 1107, aber es zeigt sich auch, dass nach "Data" und "actum" Platz für die Hinzufügung des genauen Datums und Ortes der Ausstellung gelassen wurde. Offenbar wurde dies bei der Rekognoszierung, Unterzeichnung und Versiegelung unerklärlicherweise übersehen. Gegen den Inhalt der vorliegenden Urkunde sind keine Einwände erhoben worden und können auch keine erhoben werden. Zudem erscheint der sehr genau datierte Tausch zweier Höfe durch Heinrich IV. höchst plausibel. Es ist möglich, dass dieser Tausch von Heinrich IV. nicht beurkundet wurde und dass das Sint-Servaaskapitel die Bestätigung der Rechtsregeln durch seinen Nachfolger, den römischen König Heinrich V., nutzte, um diesen Tausch schriftlich festzuhalten.
Zusammenhang und Textausgabe
In der vorliegenden Urkunde sind Teile des Textes der Urkunde des römischen Königs Heinrich V. für Lüttich vom 23. Dezember 1107 entnommen; zum Text dieser Urkunde siehe Waitz, Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 18-25, Nr. 7. Die Textteile, die aus dieser Vorurkunde stammen, sind in kleinerer Schrift dargestellt. Für Textteile, die aus dieser Vorurkunde stammen und in kleinerer Schrift gedruckt sind, siehe Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 44-45. Der Abschnitt unter Absatz 4 ist in der Bestätigungsurkunde Kaiser Friedrichs II. vom 28. Juli 1215 wiedergegeben, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 10. Für das Vidimus des römischen Königs Richard von Cornwall vom 22. September 1268, siehe Collectie Sint-Servaaska[ittel, Nr. 28. Die Lücken in A wurden zu C ergänzt.

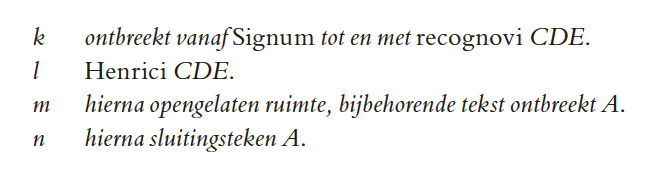


Nummer 4
Der römische König Lothar III. bestätigt den Tausch der Brüder des Sint-Servaaskapitels in Maastricht von ihrem Allodium in Monsheim gegen die Kirche von Güls mit der Abtei Hersfeld.
Der römische König Lothar III. bestätigt den Tausch der Brüder des Sint-Servaaskapitels in Maastricht von ihrem Allodium in Monsheim gegen die Kirche von Güls mit der Abtei Hersfeld.
Original
[A]. nicht verfügbar.
Abschriften
B. spätes 12./erstes Viertel 13. Jh., Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 336, nach [A]. - C. spätes 13.Jahrhundert , Ibidem, idem, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 6r-6v (= neue fol. 23r-23v), Nr. 10, nach [A]. - D. 1640, Ibidem, idem, Inv. Nr. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 17, unter der Überschrift: 12, Confirmat Lotharius est permutationem factam cum bonis de Gielsa, an [A].
Ausgaben
a. Ottenthal und Hirsch, Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza, 10-11, Nr. 9, an B. - b. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit 287, Nr. 57b (unvollständig), an B. - c. DiBe ID 5422, an a.
Zusammenfassungen
Siehe DiBe ID 5422.
Datierung
Nach Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 90, Nr. 336, stammt ddie Abschrift B aus dem dreizehnten Jahrhundert, während Ottenthal und Hirsch von einer scriptio in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ausgehen. Aufgrund seiner paläographischen Verwandtschaft mit einer undatierten Urkunde des Abtes von Kloosterrade, von Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 114-116, Nr. 52, datiert zwischen 1201 und 1211, und mit einer Urkunde des Dekans und Onze-Lieve-Vrouwkapittel in Maastricht d.d. 26. März 1225 (siehe Maastricht, HCL, Zugangsnummer 14.B001, archief kapittel Onze-Lieve-Vrouw in Maastricht, 1096-1796, Inv.-Nr. 1011) datieren wir diese Abschrift auf das Ende des zwölften/ersten Quartals des dreizehnten Jahrhunderts.
Entstehung und Textausgabe
Nach Ottenthal und Hirsch wurde der Text der vorliegenden Urkunde nicht in der königlichen Kanzlei redigiert. Der Text wurde auf der Grundlage von B redigiert, mit den Varianten von C in den Anmerkungen.


Nummer 5
Hendrik, Verwalter der Klöster Sankt-Marien in Heinsberg und Sint-Gerlach in Houthem, erklärt, dass Mathilde, Magister von Sint-Gerlach, einen jährlichen Zins von vier Schilling aus früheren Schenkungen von zwei Häusern in Aachen und einem Malter(etwa 150 l) Roggen in Daniken für die Krankenstation von Sint-Gerlach vorgesehen hat. Er gibt eine Liste des Viehbestands und genehmigt die Zuweisung von Mathilde an die Krankenstation.
Hendrik, Propst der Klöster (von St. Marie) in Heinsberg und Sint-Gerlach (in Houthem), erklärt, dass Mathilde, magistra von Sint-Gerlach, einen jährlichen Zins von vier Schilling aus zwei Häusern in Aachen und einem Roggenmalter in Daniken für das Krankenhaus von Sint-Gerlach vorgesehen hat, listet das Vieh auf und genehmigt die Zuweisung.
Original
A. Brüssel, ARA, Diverse Urkunden (Chartes diverses de la deuxième section), Kasten 1, ad date 1236 September 2 (Nr. 16594).
Anmerkungen auf der Rückseite: 1°von der Hand des 16. Jahrhunderts: Van den seickhuis. - 2°von der Handdes 17. Jahrhunderts:Nr. XXIIII.
Siegel: zwei hängend befestigte, doppelt durchstochene Siegel, angekündigt, nämlich: S2 des Klosters Sint-Marie in Heinsberg, aus weißem Wachs, beschädigt. - S3 des Klosters Sint-Gerlach in Houthem, aus weißem Wachs, beschädigt; und eine Befestigungsstelle für ein nicht angekündigtes Siegel (LS1). In Anbetracht der Positionierung wurde das erste Siegel auf der linken Seite fälschlicherweise an dieser Stelle angebracht. Für eine Beschreibung und Abbildung von S3 siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 151-153.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
a. Ramackers, 'Niederrheinische Urkunden', 77-78, Nr. 8, nach A.
Regest
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 69, Reg. Nr. 6 (datiert 1236).


Nummer 5
Anselm, freier Mann, überträgt in Anwesenheit mehrerer Zeugen freiwillig seine Tochter Mechteld und drei Morgen aus seinem eigenen Besitz in Oe an den Altar Unserer Lieben Frau in Thorn. Mechteld soll die Erträge dieses Landes erhalten, solange sie lebt. Wer gegen diese freiwillige Übertragung verstößt, dem droht die Exkommunikation.
Anselm, freier Mann, überträgt seine Tochter Mechteld sowie drei Morgen Allodialbesitz in Oe an den Altar Unserer Lieben Frau in Thorn durch die Hand von Gerard, Graf von Gelre, unter der Bedingung, daß Mechteld die Einkünfte daraus auf Lebenszeit genießen wird.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Freies Königreich Thorn, Inv.-Nr. 5. Geringfügig beschädigt.
Anmerkung auf der Rückseite: 1ovon einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: De censu capitali 1102. - 2o von Hand des 16. Jahrhunderts: De tribus bonariis terre sitis in loco de O. - 3ovon Hand des 17. Jahrhunderts: durchgestrichener Buchstabe und C.
Siegel: ein eingefügtes Siegel, nicht angekündigt, nämlich: S1 einer nicht identifizierten Person oder Institution, aus weißem Wachs, beschädigt. Zur problematischen Identifizierung und Darstellung von S1, siehe Venner, "Siegel Thorn", 16-19.
Ausgaben
a. Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 10-11, Nr. 5, nach A. - b. Habets, Archiv Thorn, 8, Nr. 5, nach a.
Regest
Haas, Chronologisches Verzeichnis, 21, Nr. 8.
Authentizität und Entstehungsgeschichte
Die Echtheit der vorliegenden Urkunde wurde von Venner und Kersken angezweifelt. Venner, "Zegels Thorn", 16-19, konnte das unangekündigte Siegel keiner Institution oder Person zuordnen. Aufgrund seiner Darstellung in Form eines Thronsiegels und seiner ovalen Form stellt er seine Echtheit in Frage. Er zieht die Möglichkeit in Betracht, daß die Urkunde ursprünglich nicht gesiegelt war und in den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts ein falsches Siegel angebracht wurde. Obwohl dies für die Echtheit der Urkunde spricht, stellt er sie dennoch in Frage. Doch abgesehen von seinem Hinweis auf Textabrogationen päpstlicher Urkunden sowie auf die bemerkenswerte Rolle des Grafen van Gelre bei der Übertragung, argumentiert er, daß die Untersuchung nach der Echtheit ansonsten außerhalb seines Beitrags liegt.
Auf der Grundlage der vorliegenden Urkunde kommt Schiffer, Grafen von Geldern, 64, zu dem Schluss, daß der Graf von Gelre bereits im Jahr 1002 die Vormundschaft über Thorn innehatte, obwohl Venner darauf hinweist, daß die erste konkrete Erwähnung als Vormund von Thorn erst aus dem Jahr 1244 stammt. Zu dieser Vormundschaftsfrage weist Kersken, Zwischen Glaube, 180, ferner darauf hin, daß die Vermittlungstätigkeit des Grafen keine direkte funktionale Beziehung zur Abtei Thorn impliziere. Er bezweifelt auch die Qualifikation des Zeugen Geldolf als Untervormund des Bischofs von Lüttich, wie von Linssen, Beitrag, 8, vermutet wird. Die ersten sicheren Berichte über eine Vormundschaft in Thorn stammen aus den Jahren 1230/1231, als die Abtei zwei Urkunden ausstellte, eine für den Herzog van Limburg über die Vormundschaft von Übach und eine für ihren Vormund, den Herzog van Brabant (Kersken, 182-183).
Kersken schließt sich Venners Argumentation hinsichtlich der Echtheit des Siegels und den daraus resultierenden Zweifeln an der Echtheit der Urkunde an. Obwohl er keine umfassende paläographisch-diplomatische Untersuchung durchgeführt hat, bringt Kersken eine Reihe von Befunden vor, die seine Zweifel verstärken. Er verweist auf die Schrift in einer "ungelenker diplomatischer Minuskel" und die längliche Invocatio in einer "ungelenker littera elongata", die nicht mit dem bescheidenen Grund für die Ausstellung dieser Urkunde vereinbar sei. Auf der Grundlage vergleichender Untersuchungen zu Duktus, Schrift, verwendeten Abkürzungen und Ligaturen kommt er zu dem vorlsichtigen Schluss, daß die Urkunde von einer vermutlich ungeübten Hand des zwölften Jahrhunderts geschrieben worden sein könnte.
Auffallend im Innern sind - nach seiner Meinung - die zweiteilige Sanctio-Formeln - konzipiert nach päpstlichem Vorbild, die man in einer "Privaturkunde" (hier eine von einer Privatperson im Namen einer Abtei ausgestellte Urkunde) nicht erwarten würde. Auch die Zeugenliste gibt zu denken. Nur im Falle der adligen Herren von Horn und Kessenich läss sich eine familiäre Verwandtschaft feststellen, doch handelt es sich in beiden Fällen um die älteste Erwähnung dieser Familien in Urkunden, die Jahrzehnte vor der nächsten Urkunde (1138 bzw. 1155) datieren. Außerdem hält er die frühe Verwendung von Ortsnamen angesichts ihrer politischen Bedeutung für unplausibel. Aufgrund dieser Einwände sagt Kersken, dass er den Verdacht gegen die vorliegende Urkunde von 1102 in Ermangelung anderer Urkunden nicht weiter erhärten kann. Dennoch neigt er zu dem Schluss, dass diese Urkunde erst später als Fälschung erstellt und mit einem gefälschten Siegel versehen wurde. Er deutet die Möglichkeit an, eine Verbindung zu einer undatierten Thorn-Urkunde herzustellen (siehe Thorn-Sammlung, Nr. 7), die Habets - seiner Meinung nach - aus paläographischen Gründen dem späten 12. Jahrhundert zuordnetet. Habets hat diese Datierung in seiner Edition jedoch nicht begründet oder die Urkunde nicht konkret auf das Ende des 12. Jahrhunderts datiert. Seine Edition stützt sich auf Franquinet, der diese Urkunde auf das "XII. Jahrhundert" datiert. Auf der Grundlage paläographischer Untersuchungen haben wir diese Urkunde in das späte 12. und frühe 13. Jahrhundert datiert (siehe Sammlung Thorn, Nr. 7).
Zusammenfassend lässt sich sagen, daß die Einwände und Vermutungen von Venner und Kersken, sowohl was die äußeren als auch die inneren Merkmale betrifft, nicht zu einer eindeutigen Erklärung für den Fall der vorliegenden Urkunde geführt haben. Möglicherweise haben wir es mit einer echten Urkunde aus dem Jahr 1102 zu tun, die zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Siegel eines bisher nicht identifizierten Siegelbewahrers versehen wurde, wie Venner vermutet. Ein nicht unlogischer Gedanke, wenn man bedenkt, dass die Siegelankündigung im Text fehlt. Es könnte sich auch um eine materielle Fälschung handeln: In diesem Fall wäre der Rechtsakt, der im frühen zwölften Jahrhundert stattfand, erst später schriftlich fixiert worden. Das bedeutet, dass der Inhalt der Urkunde echt, die Form aber falsch ist. Oder die Abtei Thorn hat ein Falsum erstellt, eine Urkunde, die sowohl inhaltlich als auch formal falsch ist.
In Bezug auf die Schrift ist Folgendes zu beobachten. Es gibt in der Tat eine instabile Schreibhand (dies ist besonders auffällig bei den Stäben des r und f, die unter die Schreiblinie gehen; beim Buchstaben p: manchmal geht eine Serife am unteren Ende des Stabes nach rechts oben, manchmal nicht). Außerdem enthält der Urkundentext eine Reihe störender Rechtschreibfehler: viginis statt virginis, Gehardus statt Gerhardus und Heinco statt Heinrico. Bemerkenswert ist die Verwendung von Verzierungen in Form einer einzelnen Schleife an den oberen Schäften der Buchstaben b, d, f, h, l und s sowie einer Schleife als Abkürzungszeichen, was an die Gitter-/Schleifenstruktur in den Urkunden des Fürstentums Lüttich erinnert.
Nach Stiennon, L'écriture diplomatique, 59, 62-63, 75, wurde die Art der mit Schleifen verzierten Schrift, die nicht auf das Bistum Lüttich beschränkt war, von deutschen Reichsurkunden entlehnt. In den Lütticher Urkunden sind die Schleifen in den 1660er Jahren noch embryonal, und die Entwicklung hin zu einer üppigen Form wird im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts eingeleitet. Im Maas-Rhein-Gebiet stabilisieren sie sich im zwölften Jahrhundert zu einer bescheidenen Form. Bemerkenswert ist, daß Stiennon die Urkunden von Thorn nicht in seine Studie aufgenommen hat, obwohl er andere (niederländisch-)limburgische Archive untersucht hat.
Kirchliche Einrichtungen in der Maasregion kannten schon früh Urkunden mit Schleifenstrukturen: Thorn erhielt 1007 eine solche Königsurkunde, die Kapitel Unserer Lieben Frau und St. Servas in Maastricht verfügen über Königs- und Bischofsurkunden aus dem 11. Jahrhundert und die Abtei Kloosterrade über eine Urkunde des Erzbischofs von Köln von 1126-1127.
Die Erforschung einer Schrifttradition innerhalb der Abtei Thorn im 11. und 12. Jahrhundert wird durch das Fehlen von Originaldokumenten aus dieser Zeit nahezu unmöglich gemacht. Wir verfügen nur über eine im 10. Jahrhundert gefälschte Königsurkunde aus dem Jahre 950 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 1), eine stark beschädigte Königsurkunde von 985 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 2), eine Königsurkunde von 1007 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 4), eine Urkunde der Äbtissin von Thorn von 1172 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 6) und eine undatierte Urkunde von Reinwidis von Übach (siehe Sammlung Thorn, Nr. 7). Das spätere Original stammt erst aus der Zeit kurz vor dem 13. Juli 1234 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 8).
Da sich nur eine einzige Urkunde im Chartarium befindet, die von der Äbtissin von Thorn ausgestellt wurde, können keine Aussagen über die spezifischen Merkmale und die Entwicklung der Schrift innerhalb der Thorn-Urkunden gemacht werden. Aber gerade diese Urkunde aus dem Jahr 1172 enthält mit der Schleifenstruktur und dem us-Kürzel in Form eines Korkenziehers die Merkmale der typischen Carolina-Schrift. Vergleicht man sie mit der vorliegenden Thorn-Charta von 1102, so fällt folgendes auf: Die Verzierungen sind nüchtern, die für 1172 charakteristischen relativ langen oberen Schäfte und Schwänze fehlen, die Enden der Buchstaben p und q sind nach rechts gebogen, was eher ein Merkmal der Buchschrift ist. Diese Schrift ist verwandt mit Urkunden aus dem Jahr 1178 (Abtei von Neufmoustier, Stiennon, L'écriture diplomatique, 94) und einer Urkunde aus den Jahren 1121-1128 (Kapitel von St. Paul in Lüttich, Stiennon, L'écriture diplomatique, Abbildung 161), die jedoch laut Stiennon wegen ihres stark gotischen Charakters nicht vor der Mitte des 12. Jahrhunderts datiert werden kann.
Der breite untere Rand der vorliegenden Urkunde mit dem Siegel auf der rechten Seite des Pergaments ist typisch für deutsche Königs- und Reichsurkunden. Die Abtei Thorn besitzt eine Urkunde des römischen Königs Heinrich II. aus dem Jahr 1007 (siehe Nr. 4 oben) mit diesem Layout und einem eingeprägten Siegel auf der rechten Seite. Diese Art von Layout ist bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts üblich, mit einer Kerbe auf der rechten Seite des Pergaments, in die das Siegel eingefügt werden konnte, wie eine Urkunde des Bischofs von Lüttich vom 28. August 1140 für die Abtei Kloosterrade beweist (siehe Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 676). Auch die Äbtissin von Thorn selbst stellte 1172 eine Urkunde in diesem Layout aus.
Hinsichtlich des Siegels stellte Venner fest, daß ein ovales Thronsiegel für 1102 bemerkenswert ist. Er wies auf ein außergewöhnlich frühes ovales Thronsiegel des Bischofs von Noyon-Doornik aus dem Jahr 1090 hin, aber die Erzbischöfe von Köln und Trier führten das Thronsiegel erst 1105 bzw. 1115 ein, die Bischöfe von Lüttich erst 1123. Hinzuzufügen ist, daß im Bistum Lüttich ovale Thronsiegel beispielsweise bei den Äbten von Sint-Truiden erst ab 1158 und 1164 bezeugt sind (siehe Brüssel, ARA, Sammlung von Siegelabdrücken, Nr. 963 und 958). Ein ovales Thronsiegel in einer Urkunde eines Privatmannes für die Abtei Thorn aus dem Jahr 1102 scheint daher ein sehr frühes Exemplar zu sein.
Was die inneren Merkmale betrifft, so entsprechen die allgemeine Diktatstruktur (invocatio/notificatio, dispositio, sanctio, corroboratio und datatio) und die Diktatformeln denen der Urkunden des zwölften Jahrhunderts. Allerdings können hier zwei weitere Bemerkungen gemacht werden. Erstens die auffällige sanctio in einer von einer Privatperson ausgestellten Urkunde, die laut Venner aus päpstlichen Urkunden entlehnt wurde. Zu dieser sanctio ist anzumerken, dass ähnliche sanctiones am Ende des elften/zwölften Jahrhunderts in den Urkunden der Lütticher Bischöfe zugunsten der Limburger Kleriker oder in Urkunden, an denen diese beteiligt waren, reichlich kursierten. Die Sanctioformel aus der Urkunde von 1102 finden wir unter anderem in zwei Urkunden von Otbert, Bischof von Lüttich, für das Kapitel Unserer Lieben Frau in Maastricht und für das Kapitel Unserer Lieben Frau in Dinant im Jahr 1096 (siehe DiBe ID 88 und DiBe ID 2594) sowie in Urkunden von Hendrik Bischof von Lüttich, zugunsten der Abteien von Heylissem, Flône, Heylissem und für die Kirche Sint-Amor in Maastricht, jeweils 1147, 1154, 1154 und 1157 (siehe Camps, ONB I, Nr. 50, und Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, Nr. 23, 24 und 28). In den von den Äbten von Sint-Truiden ausgestellten Urkunden werden solche Sanktionsformeln erst ab der Mitte des zwölften Jahrhunderts verwendet (siehe Van Synghel, DONB, Nr. 1148.09.23(nach 1147.12.24), 1167.09.23(nach 1166.12.24), 1175.12.24(nach 1174.12.24) und 1186.12.24(nach 1185.12.24)). Soweit die Überlieferung es zulässt, hat Thorn im 11. und 12. Jahrhundert keine bischöflichen Urkunden von Lüttich erhalten. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die undatierte Charta von Reinwidis (siehe Sammlung Thorn, Nr. 7, aus paläographischen Gründen jetzt auf das späte 12. und frühe13. Jahrhundert datiert) die gleiche anathema-sanctio enthält.
Eine zweite Beobachtung betrifft die Datatio: Hier fehlen sowohl das Regierungsjahr Kaiser Heinrichs als auch das Episkopatsjahr Otberts, was aber nicht außergewöhnlich ist.
Die Tatsache, daß die vorliegende Urkunde aus dem Jahr 1102 die älteste Erwähnung der Edelherren van Horn und Kessenich ist, Jahrzehnte vor der nächsten, ist kein Argument, sie für falsch zu erklären.
Die vorangegangenen Überlegungen führen zu folgendem Schluss: Die Urkunde von Anselm, freier Mann, für die Abtei Thorn aus dem Jahr 1102 kann als das Produkt einer unerfahrenen Schreibhand betrachtet werden, die eine embryonale Form der Schleifenstruktur verwendet. Diese Schleifenstruktur erscheint Jahre später, zumindest 1172, in einer schön ausgewogenen Version in einer Urkunde der Äbtissin von Thorn. Die Untersuchung der äußeren und inneren Merkmale ergab keine stichhaltigen Argumente, die den Fälschungsverdacht von Venner und Kersken stützen könnten. Gerade der embryonale Charakter und die ungeschulte Schreibhand weisen eher in Richtung einer frühen Inschrift im frühen 12. Jahrhundert. Es bleibt jedoch die Frage des Siegels. Es scheint nicht undenkbar, daß das Siegel, dessen Unterzeichner bisher nicht identifiziert werden konnte, dieser Urkunde später beigefügt wurde. Dies ist jedoch kein Grund, die vorliegende Urkunde als Falsum zu bezeichnen.


Nummer 5
Arnold I., Erzbischof von Köln, beurkundet, dass Rudolf de Turri, Ministeriale des Grafen Adolf van Saffenberg, mit Zustimmung seiner Ehefrau Waldrade und seiner Söhne Paganus, Gevehard und Herman durch seinen Herrn, den Vormund der Abtei Kloosterrade, seinen Besitz in Hubach, auf dem ein Frauenkloster (Marienthal) errichtet wurde, der Abtei geschenkt hat, und regelt das Verhältnis zwischen der Abtei und dem Tochterkloster.
Arnold I., Erzbischof von Köln, beurkundet, dass Rudolf de Turri, Ministeriale des Grafen Adolf van Saffenberg, mit Zustimmung seiner Ehefrau Waldrade und seiner Söhne Paganus, Gevehard und Herman durch seinen Herrn, den Vormund der Abtei Kloosterrade, seinen Besitz in Hubach, auf dem ein Frauenkloster (Marienthal) errichtet wurde, der Abtei geschenkt hat, und regelt das Verhältnis zwischen der Abtei und dem Tochterkloster.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 675.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 19-22, Nr. 6, nach A.
Authentizität
Zur möglichen Unechtheit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 5
Der römische König Konrad III. schenkt die Maasbrücke in Maastricht dem Maastrichter Sint-Servaaskapitel.
Der römische König Konrad III. schenkt die Maasbrücke in Maastricht dem Maastrichter Sint-Servaaskapitel.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 435.
Siegel: ein aufgedrücktes Siegel, das angekündigt wurde, nämlich: S1 des römischen Königs Konrad III, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Zegels", Nr. 43.
Abschriften
B. 25. März 1282, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 438, Einschub in eine Urkunde des römischen Königs Rudolf I., nach A. - C. spätes 13. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 8v-9v (= neu fol. 25v-26v), Nr. 15, nach A. - D. spätes 13. Jh., Ibidem, idem, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 21r-22r (= neu fol. 38r-39r), Nr. 43, nach B. - E. 14. Jh., Ibidem, Zugang Nr. 14.B002H, archief Broederschap der kapelanen van Sint-Servaas te Maastricht, 1139-1797, Inv. Nr. 6, Kopie zu A. - F. 1640, Ibidem, idem, Inv. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 20-21, unter der Überschrift: 15, Donatio pontis Mose Conrardi secundi, nach A. - [G]. nicht vorhanden, aber bekannt aus H, Kartular des Sint-Servaaskapitels in Maastricht = Liber A, fol. 2v. - H. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartular) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, S. 147-148, unter der Überschrift: Conrardus, Romanorum rex, concedit canonicis Sancti Servatii omnia iura et emolumenta in pontem supra Mosam quam nostri iuris indubitanter esse constat, 10ma calendas julii, anno 1139, beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, nach A.
Ausgaben
a. Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, 49-50, Nr. 31, nach A. - b. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 291, Nr. 64 (unvollständig), nach A. - c. DiBe ID 6101, nach a.
Zusammenfassungen
Siehe DiBe ID 6101.
Ursprung und Kohärenz
Nach Hausmann, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, 49, wurde diese Urkunde nach dem Vorbild einer päpstlichen Urkunde, von Arnoud, Kanzler des römischen Königs Konzil III. herausgegeben und von Arnoud A, einem der in der Kanzlei tätigen Notare, mundiert.
Diese Schenkung wurde von Papst Innozenz II. am 18. Dezember 1139 bestätigt, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 6. Am 17. September 1274 erließ der römische König Rudolf I. eine Urkunde über die Instandhaltung der Maasbrücke, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 39. Am 25. März 1282 bestätigt und erneuert der römische König Rudolf I. die Schenkung des römischen Königs Konrad, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 46. Der von vier Erzbischöfen und fünfzehn Bischöfen gewährte Ablass für den Bau der Maasbrücke vom 29. Januar 1284 und die Genehmigung von Jan IV. (van Vlaanderen), Bischof von Lüttich, vom 8. Mai 1287, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 51 und 57.


Nummer 6
Beatrix, Herrin von Valkenburg, bestätigt, dass Gerard Buc vor ihr, ihren Bediensteten, allen Einwohnern von Valkenburg und ihren Getreuen erklärt hat, dass sein Vater, Herr Emmo van Klimmen, dem Kloster Sint-Gerlach ein Haus mit Land in Voheim geschenkt hat. Das Haus war Teil seiner freien Besitztümer und wurde ordnungsgemäß auf ewig an das Kloster übertragen.
Beatrix, Herrin von Valkenburg, beurkundet, daß Gerard Buc vor ihr, ihren Ministerialen, allen Einwohnern von Valkenburg und ihren Gläubigen erklärt hat, daß sein Vater, Herr Emmo von Klimmen, aus seinem Allodialbesitz ein Haus mit Land in Voheim dem Kloster Sint-Gerlach geschenkt hat und daß dieses ordnungsgemäß in ewigen Besitz übertragen wurde.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 95, Reg. Nr. 2.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Beatrix, Dame van Valkenburg, aus hellbraunem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 156-157.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
a. Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 3-4, Nr. 2, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar von Sint-Gerlach, 67-68, Reg. Nr. 2 (datiert zwischen 1228 und 1237). - Idem, Chronologische Liste, 38, Reg. Nr. 67 (datiert 1228-1237).
Datierung
Diese Urkunde kann nur ungefähr datiert werden. In der vorliegenden Urkunde handelt Beatrix als Herrin van Valkenburg nach dem Tod von Dirk I., Herr van Valkenburg, im Namen ihres Sohnes Dirk, "adhuc puero". Terminus post quem ist der Tod von Dirk I. am 4. November 1227. Terminus ante quem ist das Jahr 1237, in dem Dirk II. erstmals als Herr van Valkenburg in Erscheinung tritt (siehe Venner, "Das erste Rittersiegel", 57, und Corsten, "Die Herren", 178-181).
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 6
Odilia, Äbtissin von Thorn, gibt bekannt, daß Godfried van Heinsberg die Magd Aleid, die zur Kirche von Geilenkirchen gehörte, mit Zustimmung des Pfarrers von Geilenkirchen als Ministeriale in die Kirche von Thorn versetzt hat. In Anwesenheit mehrerer Zeugen und Berater legte Aleid den Eid auf die Kirche von Thorn ab und gelobte der Äbtissin Treue. Sollte Aleid Kinder zur Welt bringen, wird ihr letzter Sohn ihr Erbe antreten. Wenn sie keinen Sohn hat, wird dies die letzte Tochter sein. Alle anderen Kinder werden zwischen der Kirche von Thorn und Godfried van Heinsberg aufgeteilt.
Odilia, Äbtissin von Thorn, erklärt, daß Godfried, Herr van Heinsberg, die Magd Aleid, die zur Kirche von Geilenkirchen gehört, mit Zustimmung von Gozewijn, Pfarrer dort, der Kirche von Thorn als Ministeriale übertragen hat und daß ihre Kinder zwischen Godfried und der Kirche aufgeteilt werden.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Freies Königreich Thorn, Inv.-Nr. 6. Liniert, leicht beschädigt.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: De censu capitali. - 2o von einer Hand ausdem 16. Jahrhundert: 1172. - 3o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: V, k.
Siegel: ein auf der Urkunde angebrachtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 der Abtei Thorn, aus weißem Wachs. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Thorn", 31-33.
Ausgaben
a. Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 8-10, Nr. 4, nach A (datiert 1172). - b. Habets, Archiv Thorn, 9-10, Nr. 6 (datiert 1172), nach a.
Regest
Haas, Chronologisches Verzeichnis, 29, Nr. 35.
Datierung
Es wird angenommen, daß der Weihnachtsstil in der Diözese Lüttich verwendet wurde, siehe Camps, ONB I, XX, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII. Der terminus ante quem wird durch das Ende der angegebenen fünften Indiktion bestimmt.


Nummer 6
Arnold I., Erzbischof von Köln, bestätigt der Abtei Kloosterrade den Erwerb einer Reihe von namentlich genannten Gütern.
Arnold I., Erzbischof von Köln, bestätigt der Abtei Kloosterrade den Erwerb einer Reihe von namentlich genannten Gütern.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 677. Einige Textverluste aufgrund von Abnutzung, insbesondere auf der linken Seite.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 25-28, Nr. 8, nach A.
Authentizität
Zur möglichen Unechtheit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.
Textausgabe
Zur Vervollständigung der beschädigten Textpassagen siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 6
Papst Innozenz II. bestätigt die Schenkung der Maasbrücke in Maastricht durch den römischen König Konrad III. an das Maastrichter Sint-Servaaskapittel
Papst Innozenz II. bestätigt die Schenkung der Maasbrücke in Maastricht durch König Konrad III. an das Maastrichter Sint-Servaaskapitel.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 436. Gefüttert. Leicht beschädigt mit Textverlust.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: Confirmatio privilegii pontis (von späterer Hand ergänzt) per Innocentium II. - 2o von einer Hand aus dem 15. Jahrhundert: R XXXVII. - 3o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: Excopiatum nu. 12 - 4o von einer Hand des 17. Jahrhunderts: In capsula pontificum. - 5ovon einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: 41 Cap. Ia.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Papst Innozenz II. Für eine Beschreibung von S1, siehe Venner, "Zegelsl", Nr. 1.
Kopie
B. erste Hälfte des 17. Jahrhunderts (vor 1648), Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 11 (Kartularium) = Cartularium ecclesiae collegialis Sancti Servatii Traiecti ad Mosam, tomus primus, pontificalia et episcopalia, fol. 13r-14r, unter caput: Pontificalia, und unter Rubrik: Innocentius 2 confirmat donationem pontis cum illius reficiendi obligatione et reliqui fructus inter prepositum et fratres divisione ac administrationis paritate, beglaubigte Abschrift von Hendrik Lenssens, Kapitelsekretär und öffentlicher Notar, bevollmächtigt durch den Raad von Brabant, an A.
Ausgaben
a. Schaepkens, 'Archives', 171-172, nach B. - b. Willemsen, 'Inventaire', 164-165, Nr. 4, nach A. - c. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 292, Nr. 64b (unvollständig), nach A.
Zusammenfassungen
Wauters, Tale chronologique II, 212. - Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, 892, Nr. 8064. - Doppler, 'Verzameling', 243-244, Nr. 43.- Haas, Chronologische lijst, 23-24, Nr. 17. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 100, Nr. 436. - DiBe ID 8241.
Kohärenz
Zur Schenkung der Maasbrücke durch den römischen König Konrad III. siehe Collectie Sint-Servaass, Nr. 5. Am 17. September 1274 erließ der römische König Rudolf I. eine Urkunde über die Instandhaltung der Maasbrücke, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 39. Für die Ablassverkeihung durch vier Erzbischöfe und fünfzehn Bischöfe für den Bau der Maasbrücke vom 29. Januar 1284 und die Genehmigung von Jan IV. (van Vlaanderen), Bischof von Lüttich, vom 8. Mai 1287, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel Nr. 51 und 57.

Nummer 7
Jan, Verwalter, und der Konvent des Sankt-Marien-Klosters in Heinsberg teilen dem Verwalter und dem Konvent von Sint-Gerlach in Houthem mit, dass sie einander von alters her in Frömmigkeit und Glauben verbunden sind und dass sie unter anderem deshalb den Brüdern und Schwestern ihrer Gemeinschaft und auch den Geistlichen und den Laien, die gebührenden Gedenkgottesdienste erweisen werden. Sie werden davon absehen, wenn beide Klöster dies für bedenklich halten oder schriftlich festgelegt haben, dass es zu gefährlich wäre.
Jan, Propst, und Konvent des Klosters (Sint-Marie) in Heinsberg teilen dem Magister und Konvent von Sint-Gerlach (in Houthem) mit, daß sie von alters her verbunden sind und die üblichen Gedenkgottesdienste für die Brüder und Schwestern ihrer Gemeinschaft -sowohl Kleriker als auch Laien -durchführen werden, es sei denn, beide haben vereinbart und schriftlich festgehalten, daß dieses zu beschwerlich und gefährlich ist.
Original
[A]. Nicht verfügbar.
Abschriften
[B]. vor 1735, nicht verfügbar, aber bekannt aus dem Abschnitt in C. - C. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archive klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 357, unter dem Abschnitt: Copia literarum amplissimi domini Ioannis, prepositi de Heinsbergh, und am Rande: Num. 217, ohne Angabe der Siegelstellen, zu [B].
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Datierung
Man geht davon aus, daß die Bischöfe von Lüttich um 1230 vom Weihnachtsstil zum Osterstil übergingen und daß die religiösen Einrichtungen des Bistums einige Zeit später diesem Beispiel folgten, siehe Camps, ONB I, XXI.Folglich wird bei der Datierung der vorliegenden Urkunde von derVerwendung des Osterstils ausgegangen.


Nummer 7
Reinwidis van Übach verkündet, daß sie von ihren Eltern in der Vergangenheit dem Altar Unserer Lieben Frau in Thorn unter folgendem Recht gestiftet wurde: ihre Söhne werden jedes Jahr am 11. November einen bestimmten Geldbetrag an diesen Altar überweisen, ihre Töchter werden einen Betrag über einen männlichen Verwandten ihrer Wahl bezahlen; sie werden auch für die Erlaubnis bezahlen, ohne die Last oder Einmischung eines Vormunds zu heiraten; bei ihrem Tod werden sie einen sehr guten Vierbeiner aus ihrem eigenen Besitz zur Verfügung stellen. Wenn ein eigener Vierbeiner nicht möglich ist, werden sie ein sehr gutes getragenes Kleidungsstück geben. Allen, die gegen diese Urkunde verstoßen, droht die Exkommunikation.
Reinwidis van Übacherklärt, daß sie und ihre Nachkommen der Abtei Thorn cijns- und keurmedepflichtig sind..
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 7.
Anmerkung auf der Rückseite: 1ovon einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Littera certa (?) de Vbach Regewidis de curmede et ut sue posteri nubere possent. - 2ovon einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: J durchgestrichen, V. - 2o von einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: Littera Regewidis quod posteri eius nubere possent.
Siegel: eine Befestigungsstelle, vermutlich für das angekündigte Siegel der Abtei Thorn (LS1).
Ausgaben
a. Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 11, Nr. 6 (aus dem 12. Jahrhundert), nach A. - b. Habets, Archiv Thorn, 10, Nr. 7 (aus dem 12. Jahrhundert), nach a.
Regest
Haas, Chronologisches Verzeichnis, 33, Nr. 50.
Datierung
Die vorliegende Urkunde wurde nicht datiert. Franquinet und daraufhin Habets haben diese Urkunde ohne weitere Argumente in das zwölfte Jahrhundert datiert. Aus paläographischen Gründen kann sie auf das späte 12. und frühe 13. Jahrhundert datiert werden. Das Dokument weist einen informellen Charakter auf, der durch die Verwendung eines kleinen, schief ausgeschnittenen Pergamentstücks, das schlampige Layout und die unregelmäßigen Zeilenabstände bedingt ist. Außerdem sind die Wörter expungiert und überlagert. Die Charta ist nicht in einer diplomatischen Minuskel geschrieben, wie sie im zwölften Jahrhundert weit verbreitet war, sondern enthält eine Reihe von Merkmalen der gotischen Schrift (Kratzspuren, schräges d) mit einem etwas gestellten Charakter. Letzteres spiegelt sich auch in der Verwendung von Majuskeln in den Wörtern Marie und Martini wider .
Ein Vergleich dieser Urkunde mit den Limburger Urkunden bis ca. 1240 hat gezeigt, daß diese Art von Schrift erst um die Wende vom zwölften zum dreizehnten Jahrhundert auftritt. Stark verwandte Schriftstücke wurden in einer Urkunde des Abtes von Kloosterrade aus dem Zeitraum 25. Dezember 1201- 30. April 1211 (Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv. Nr. 846) und in einer Urkunde von Lothair, Graf von Hochstaden, über die Zehnten in Noorbeek und 's-Gravenvoeren aus dem Jahr 1204 (Ibidem, Zugang Nr. 14.D022, Jesuitenarchiv Maastricht, Inv. Nr. 55) gefunden. Eine Datierung in das späte zwölfte/frühe dreizehnte Jahrhundert ist daher naheliegend.


Nummer 7
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
Scheinbar original
<A>. Maastricht, HCL, toegangsnr. 14.D004, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 782.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 43-46, Nr. 14, nach A.
Authentizität
Diese Charta ist zweifelsohne eine Fälschung und entstand vier oder fünf Jahrhunderte später, siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.
Textausgabe
Die häufige Verwendung des übergeordneten o auf u oder v wurde nicht übernommen.


Nummer 7
Siegfried, Dekan, und die Kanoniker des Sint-Servaaskapitels in Maastricht setzen Marsilius, Abt von Saint-Gillis auf dem Publémont bei Lüttich, in den Besitz von neun "bunder beim Dorf Aaz und drei "Höfe in Aaz, so dass die Abtei diese in erblichem Besitz hat, solange der Abt nicht gegen die festgelegten Bedingungen verstößt.
Siegfried, Dekan, und die Kanoniker des Sint-Servaaskapitels in Maastricht setzen Marsilius, Abt von Saint-Gillis auf dem Publémont bei Lüttich, in den Besitz von neun "bunder beim Dorf Aaz und drei "Höfe in Aaz, so dass die Abtei diese in erblichem Besitz hat, solange der Abt nicht gegen die festgelegten Bedingungen verstößt.
Original
[A]. Nicht verfügbar.
Kopie
B. gleichzeitig, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1707, Inv.-Nr. 306, stark beschädigt, zu [A].
Ausgaben
a. Habets, "Codex diplomaticus", 31-33, Nr. 37 (datiert 1173), an B. - b. Flament, "Het Rijksarchief", 434-435 (datiert 1173), an B. - c. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit 300-301, Nr. 78 (unvollständig) (datiert 1173), an B.
Zusammenfassungen
Doppler, "Verzameling", 250-251, Nr. 51 (datiert 1173). - Haas, Chronologische lijst, 29-30, Nr. 36 (datiert 1173). - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 86, Nr. 306 (aus dem Jahr 1173). - DiBe ID 10985 (datiert 1173).
Datierung
Die Verwendung des Weihnachtsstils in der Diözese Lüttich wird angenommen. Der terminus ante quem wird ferner durch das Ende der angegebenen sechsten Indiktion bestimmt, die bis zum 23. September 1173 läuft.
Herkunft
Das Pergament der vorliegenden Urkunde ist stark beschädigt und die letzten drei Zeilen wurden um eine große kreisförmige Aussparung herum geschrieben. In dieser Aussparung wurden mit einer Quarzlampe Spuren eines anderen Textes entdeckt, was darauf hindeutet, dass das Pergament neurverwendet wurde. Höchstwahrscheinlich hat das Sint-Servaaskapitel fast zeitgleich eine Kopie für seine eigenen Pachtbücher angefertigt. Flament, "Het Rijksarchief", 434, hält das unter B erwähnte Dokument für das Original, genauer gesagt für eine Neufassung der Vereinbarung mit der Abtei Sint-Gillis auf dem Publémont in Lüttich. In diesem Fall hätte sie auf den Namen der Lütticher Abtei lauten müssen. Er weist auch auf ein Siegel hin, das abgefallen ist, aber es wurden keine Spuren von Wachs auf dem Pergament gefunden. Zwar ist ein Teil des Urkundentextes um die Aussparung herum geschrieben, was auf die Anbringung eines gedruckten Siegels hindeuten könnte, aber es ist weder ein Schnitt noch ein Stück Pergament vorhanden, um das Siegel daran zu befestigen. Dies macht es unwahrscheinlich, dass diese Charta jemals gesiegelt wurde. Auch der Urkundentext kündigt keine Siegelung an. Eine zeitgenössische Abschrift durch das Sint-Servaaskapitel ist daher naheliegend.
Textausgabe
Die Lücken in B wurden nach der Ausgabe durch Flament ausgefüllt, die eine bessere Ausgabe als Habets ist.



Nummer 8
Dirk II., Herr von Valkenburg,hat dem Verwalter und dem Kloster Sint-Gerlach in Houthem seinen Wald Vorbusde, der zu seinem Grundbesitz in Houthem gehörte, verkauft, und schenkte dem Kloster einen Teil des Kaufpreises.
Dirk II., Herr van Valkenburg,verkaufte der Propstei und dem Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) seinen Wald Vorbusde, derim Allodium von Houthem lag, und schenkte dem Kloster einen Teil des Kaufpreises.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 40, Reg. Nr. 7.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1° von der Hand des 13. Jahrhunderts: Littera de silva monasterii.- 2°von der Hand aus dem letsten Viertel des 14. Jahrhunderts: A j. - 3° von der Hand des 17. Jahrhunderts: 1241.- 4°von der Handdes 18. Jahrhunderts: Num. 62.
Siegel: zwei hängend befestigte Siegel, angekündigt, nämlich: S2 von Dirk II, Herr van Valkenburg, aus grünem Wachs, beschädigt, mit CS2, beschädigt. - S4 von Gozewijn Dukere, aus hellbraunem Wachs, beschädigt; und zwei Befestigungsstellen zu den angekündigten Siegeln von Alard van Haasdal, Ritter, und Adam van Borgharen, Ritter, (LS1) und (LS3). Für eine Beschreibung und Abbildung von S2, CS2 und S4, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 157 bzw. 160.
Abschriften
[B]. vor 1506, authentische Abschrift, nicht verfügbar, aber bekannt aus [C], nach A. - [C]. 1506, nicht verfügbar, aber bekannt aus F, Register des Klosters Sint-Gerlach in Houthem, das fälschlicherweise das Datum 13. März 1241 angibt, nach [B]. - [D]. vor dem 6. Mai 1594, nicht verfügbar, aber bekannt aus [E], authentische Abschrift des Klosters Sint-Gerlach in Houthem zugunsten des Rates von Brabant, wahrscheinlich an [B]. - [E]. 6. Mai 1594, nicht verfügbar, aber bekannt aus F, Urkunde von Philipp II., König von Spanien, in der die nachstehende Urkunde eingeschrieben ist, an [D]. - F. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erfffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 100-104, unter der Überschrift: Confirmatio donationis piscature et venationis de anno 1594, und am Rande: Num. 62, zu [E].
Ausgabe
a. Franquinet, aufgezeichnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 9-10, Nr. 6 (datiert 1241 März), nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 69-70, Reg. Nr. 7 (datiert 1241 März). - Idem, Chronologische Liste, 43, Reg. Nr. 84 (datiert 1241 März).
Datierung
Die Verwendung des Osterstils in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII. Da der Monat März in der Osterzeit 1241 vom 1. bis zum 30. März läuft und der 31. März in das Jahr 1242 fällt, ist sowohl eine Datierung vom 1. bis 30. März 1241 als auch vom 31. März 1242 möglich.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 8
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn haben mit Zustimmung ihrer Mitkanoniker und Ministerialen aus Furcht vor Wuchern folgende Vereinbarung getroffen, die acht Jahre lang gelten soll, um ihre großen Schulden zu tilgen, die durch Brände, Stürme und Raubüberfälle entstanden sind. Zur Tilgung der Schulden werden die Einkünfte der Höfe von Baarle und Gilze mit den Zehnten, aber ohne die Nebengebäude, sowie die Zehnten von Hemert und Avezaath, beiseite gelegt. Zur Verteilung an die Nonnen werden zugewiesen: die Höfe von Thorn (mit Ausnahme des kleinen Zehnten von Thorn), Neer und Eisden, die Cijns (Abgaben) und die Verwaltung von Oeteren, die Felder von Übach mit dem Zehnten, die Güter von Bergeijk und die Insel gegenüber Wessem; die Lehnsrechte und das Recht auf die tote Hand der Höfe von Neer und Eisden. Der Äbtissin wird zugewiesen: der kleine Zehnte von Thorn (ohne die Zehnten der dazugehörigen Güter), die dazugehörigen Güter und die Lehnsrechte und das Recht auf die tote Hand der Höfe von Baarle und Gilze, der Hof von Oeteren ohne die Cijns und die Verwaltung, der Hof von Grathem.
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn verwenden für einen Zeitraum von acht Jahren die Einkünfte aus einer Reihe von Gütern, darunter die Höfe mit den Zehnten in Baarle und Gilze sowie die Zehnten von Hemert und Avezaath, zur Schuldentilgung und teilen sich die Verwaltung der Güter.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 13.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 217-219, Nr. 973, nach A.


Nummer 8
Hendrik II., Bischof von Lüttich, bestätigt die Schenkung der Kirche von Spaubeek mit dem gesamten Zehnten und der Dos und zwei Höfen von zwölf "bunder" (Hektar) an die Abtei Kloosterrade durch Adelheid, die Ehefrau von Reinier van Beek.
Hendrik II., Bischof von Lüttich, bestätigt die Schenkung der Kirche von Spaubeek mit dem gesamten Zehnten und der Dos und zwei Höfen von zwölf "bunder" "(Hektar) an die Abtei Kloosterrade durch Adelheid, die Ehefrau von Reinier van Beek.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 817.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 47-49, Nr. 16, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 8
Beurkundet wird die Einigung in einem Streit zwischen den Kanonikern des Sint-Servaaskapitels in Maastricht und der Abtei Siegburg über den Zehnten in Güls.
Beurkundet wird die Einigung in einem Streit zwischen den Kanonikern des Sint-Servaaskapitels in Maastricht und der Abtei Siegburg über den Zehnten in Güls.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 338.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Item de Gulse, von anderer Hand hinzugefügt: et Sybergense, XXXIII. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: P XVI / N I II. - 3o von einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: Contractus inter abbatem Siburgensem et capitulum Traiectense de quinque caratis vini / B10 / 1189.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, nicht angekündigt, nämlich: S1 der Abtei Siegburg, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1 siehe Venner, "Zegelsl", Nr. 39.
Abschriften
B. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (Kartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 16r-16v (= neues fol. 33r-33v), Nr. 33, nach A. - [C]. nicht vorhanden, aber bekannt aus D, Kartularium des Sint-Servaaskapitels in Maastricht = Liber A, fol. 70. - D. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartularium) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1399, S. 210, unter der Überschrift: Transaction tusschen het capittel van St. Servaes ende de moniken van het clooster Cibryen, waerbij voorg. closter cedes haere tyndens soe van lant, weyden, wyngaerdens as van de beesten, gehoorende onder de parochie van Gulsen waergens waarvoor het capittel jaarlijkslycs sal geven vyff caratteren wijn van haar gewasch, niet van den besten, noch niet van den slechtchsten, de 7 indictie 1189, Kopie von G.J. Lenarts, Stadtsekretär von Maastricht, möglicherweise nach [C].
Ausgabe
a. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 304, Nr. 87 (unvollständig) (datiert 1189), nach A.
Zusammenfassungen
De Borman, "Notice", 25 (datiert 1189) - Doppler, "Verzameling", 254-255, Nr. 58 (datiert 1189). - Haas, Chronologische lijst, 32, Nr. 44 (datiert 1189). - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 90, Nr. 338 (datiert 1189). - DiBe ID 6187 (datiert 1189).
Datierung
Es wird angenommen, dass der Weihnachtsstil sowohl in der Diözese Lüttich als auch im Erzbistum Köln verwendet wurde, siehe Camps, ONB I, XX, Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII, und Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, XVI. Der terminus ante quem wird durch das Ende der angegebenen siebten Indiktion bestimmt, die bis zum 23. September läuft.
Ursprung und Kohärenz
Eine Neufassung dieser Urkunde wurde im Namen der Abtei Siegburg und der Kanoniker des Sint-Servaaskapitels in Maastricht mit derselben Datierung erstellt. Diese Urkunde ist im Original erhalten und wird im Landesarchiv in Duisburg, NRW Abteilung Rheinland, AA 0504 /Siegburg, Urkunden, Nr. 63 aufbewahrt. Für eine Ausgabe dieser Neufassung, siehe Beyer, Eltester und Goerz, Urkundenbuch, 132, Nr. 95 (datiert 1189) und Wisplinghoff, Urkunden Siegburg, 168-169, Nr. 77. Nach Wisplinghoff wurden beide Originale von derselben Hand geschrieben. Für die Anerkennung des Rechts auf den Zehnten von Güls durch den Abt von Siegburg vom 4. November 1263, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 23.


Nummer 9
Die Schöffen (Ratsherren) von Maastricht verkünden die Einigung im Streit um die Güter des Ritters Godfrey von Heer, zwischen dem Verwalter und dem gesamten Konvent von Sint-Gerlach in Houthem einerseits und Wolter van Mesch, Bürger von Maastricht, Jutta und Mathilde, Enkelinnen von Godfrey von Heer, und ihrem Vormund Leonius andererseits. In Anwesenheit der Ratsherren von Maastricht, des Bürgermeisters und der Ratsherren von Heer sowie von Verwandten und Freunden von Jutta und Mathilde vereinbarten die Parteien, dass der Verwalter und der Konvent von Sint-Gerlach von den strittigen Gütern fünf "bunder" (= etwa 4 ha) Ackerland, das zum Hof van Heer gehörte, als Erbbesitz erhalten sollen. Wolter van Mesch, Vormund Leonius, und Mathilde, die Mutter von Jutta und Mathilde, verzichten zu Gunsten des Verwalters und des Klosters auf die genannten fünf "bunder" Land. Der Verwalter und der Konvent verzichteten ihrerseits zu Gunsten von Wolter, Jutta und Mathilde auf alle anderen Güter von Godfrey von Heer, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Maastricht.
Die Schöffen von Maastricht bescheinigen bezüglich des Streits um die Güter des Ritters Godfried van Heer zwischen der Propstei und dem Konvent von Sint-Gerlach (in Houthem) einerseits und Wolter van Mesch, Bürger von Maastricht, Jutta und Mathilde, Töchter von Adam, Sohn von Godfried van Heer, und deren Vormund Leonius andererseits, daß vor ihnen, Schulze und Schöffen von Heer und Verwandte und Freunde von Jutta und Mathilde vereinbart ist, daß Propst und Konvent von Sint-Gerlach von den strittigen Gütern fünf Morgen Ackerland in Besitz haben werden, abhängig vom Hof van Heer, nach erblichem Recht. Wolter, Leonius und Mathilde, die Mutter von Jutta und Mathilde, haben die genannten fünf Morgen zugunsten der Propstei und des Konvents abgetreten, und die Propstei und der Konvent haben ihrerseits zugunsten von Wolter, Jutta und Mathilde auch auf alle anderen Güter von Godfrey van Heer verzichtet, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Maastricht.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 34, Reg. Nr. 8. Gefüttert.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von der Hand des 13. Jahrhunderts: Littera de Heer. - 2o von der Hand aus dem letzten Vierteldes 14. Jahrhunderts: X. - 3o von der Hand des 17. Jahrhunderts: 1253. - 4ovon der Hand des 18. Jahrhunderts: Litere Godefridi de 5 bonnariis in Here, num. 75.
Siegel: vier hängend befestigte, doppelt durchstochene Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Godfried Dives, Schöffe von Maastricht, aus weißem Wachs, beschädigt. - S2 von Manegold, Schöffe von Maastricht, aus weißem Wachs, beschädigt. - S3 von Godfried, Sohn von Frau Osa, Schöffe von Maastricht, aus weißem Wachs, beschädigt. - S4 von Boudewijn de Molendino, Ratsherr von Maastricht, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung von S1, S2, S3 und S4, siehe Venner, 'Siegelkloster Sint-Gerlach', 160-162.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 121-122, unter der Überschrift: Litere Godefridi de 5 bonnariis terre arabilis de Lord hereditarie possidendis, und am Rande: Num. 75, mit Angabe von vier Siegelstellen, nach A.
Ausgaben
a. Franquinet, aufgezeichnetes Inventar Sint-Gerlach, IV, 10-12, Nr. 7 (vom April 1253), nach A. - b. Nève, Die Schöffenurkunden aus dem 13. Jahrhundert, 3-4, Nr. 1253.04.00 (mit Übersetzung), (vom April 1253), nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 70, Reg. Nr. 8. (datiert April 1253). - Idem, Chronologische Liste, 48, Reg. Nr. 101 (datiert April 1253).
Datierung
Die Verwendung des Osterstils in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII. Da das Osterjahr 1253 vom 18. März 1253 bis zum 10. April 1254 läuft, ist sowohl eine Datierung vom 18. bis 30. April 1253 als auch vom 1. bis 9. April 1254 möglich.
Herkunft
Die Handschrift der vorliegenden Urkunde weist Ähnlichkeiten auf mit derjenigen der Urkunde von Dirk II., Herr van Valkenburg, datiert 1254.07.05, sowie mit der Hand, die vier Jahre später zwei Urkunden für das Kloster Sint-Gerlach prägte, siehe infra Nr. 10, 13 und 14. Diese Originale haben auch das gleiche Layout: Der Schreiber schrieb den Urkundentext nicht auf den aufgetragenen Linierung, sondern weit über diese Linien.


Nummer 9
Hendrik IV., Herzog van Limburg und Graf van Berg, teilt mit, daß die Äbtissin und der Konvent der Abtei Thorn ein Gehöft in Drinhausen an Jan, Kleriker von Körrenzig und Kanoniker von Lüttich, übertragen haben. Jan hat dieses Gehöft bezahlt, so daß er, solange er lebt, frei darüber verfügen kann. Nach seinem Tod werden seine Güter frei an Thorn zufallen.
Heinrich IV., Herzog von Limburg und Graf von Berg, gibt bekannt, daß Äbtissin und Konvent von Thorn an Jan, Kleriker von Körrenzig und Kanoniker von Lüttich, für die Dauer seines Lebens ein Gehöft in Drinhausen übertragen haben.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 14.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1ovon einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: De curte de Drinhusen. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Donatio, 1235. - 3o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: J, V.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Heinrich IV, Herzog van Limburg und Graf van Berg, aus weißem Wachs, beschädigt; mit beschädigtem Gegensiegel CS1. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1 und CS1, siehe Venner, "Siegel Thorn", 38-39.
Kopie
B. erste Hälfte des 15. Jahrhunderts, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Freies Königreich Thorn, Inv. Nr. 1628 (ehemals Cartularium Nr. 1) = Cartularium abbatiae imperialis Thorensis, 966-1600, S. 97 (altes fol. 53r), unter Rubrik: E, De censu in Bergheyke, nach A.
Ausgaben
a. Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 13-14, Nr. 8 (von 1235 Dezember), an B. - b. Habets, Archiv Thorn, 13-14, Nr. 14 (von Dezember 1235 ) , an A.
Regest
Haas, Chronologische Liste, 43, Nr. 83 (datiert 1235 Dezember).
Datierung
Es wird angenommen, daß die Bischöfe von Lüttich um 1230 vom Weihnachts- zum Osterstil übergingen und daß die religiösen Institute im Bistum Lüttich erst einige Zeit später folgten, siehe Camps, ONB I, XXI.Die Datierung der vorliegenden Urkunde geht also vonderVerwendung des Weihnachtsstils aus. Es ist nicht offensichtlich, daß diese Urkunde in der Umgebung des Urkundenerstellers, des Herzogs van Limburg, entstanden ist, da Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, XVI-XVII, argumentieren, daß es keine Belege für eine herzogliche Kanzlei in dieser Zeit gibt. Für die Urkunden aus der Zeit zwischen 1200-1230 gingen sie von der Verwendung des Weihnachtsstils in den herzoglichen Urkunden aus. Wenn die vorliegende Urkunde tatsächlich aus dem Umfeld des Herzogs van Limburg stammt und im Osterstil datiert ist, stammt sie aus dem Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 1235.


Nummer 9
Arnold I., Erzbischof von Köln, bestätigt der Abtei Kloosterrade den Besitz von Gütern in Bornheim, die Jan von Bornheim übertragen hat, in Ameln, von Gütern, die er von Abt Folmer von Lonnig und anderen gekauft hat, und von Gütern in Niedermerz, die Werner Rufus von Niedermerz geschenkt hat.
Arnold I., Erzbischof von Köln, bestätigt der Abtei Kloosterrade den Besitz von Gütern in Bornheim, die Jan von Bornheim übertragen hat, in Ameln, von Gütern, die er von Abt Folmer von Lonnig und anderen gekauft hat, und von Gütern in Niedermerz, die Werner Rufus von Niedermerz geschenkt hat.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 778.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 49-51, Nr. 17, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 9
Wilhelm, Archidiakon von Trier, erklärt, dass Willem, Vogt von Chiny, das Patronatsrecht der Kirche von Jamoigne an die Abtei von Orval übertragen hat und dass Blihard, Kanoniker von Reims und Pfarrer von Jamoigne, Bruder des Vogts von Chiny, seine Rechte an die Abtei übertragen hat.
Wilhelm, Archidiakon von Trier, erklärt, dass Willem, Vogt von Chiny, das Patronatsrecht der Kirche von Jamoigne an die Abtei von Orval übertragen hat und dass Blihard, Kanoniker von Reims und Pfarrer von Jamoigne, Bruder des Vogts von Chiny, seine Rechte an die Abtei übertragen hat.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 1791. Liniiert.
einer Hand des 14. Jahrhunderts XVII. - 2o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: Pro patronatu et investitura ecclesie de Jamoigne. - 3o von einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: Jamoigne 1193.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Wilhelm, Archidiakon von Trier, aus rotem Wachs, makellos. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Zegels", Nr. 17.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgaben
a. Goffinet, Cartulaire, 110-111, Nr. LXXI (unvollständig) (datiert 1193), nach einer Kopie in einem Kartular der Abtei von Orval. - b. DiBe ID 2465 (datiert 1193), nach a.
Zusammenfassungen
Wauters, Table chronologique VII, 386 (datiert 1193). - Tandel, "Les communes Luxembourgoises", 437, Nr. 8 (datiert 1193). - Haas, Chronologische lijst, 32, Nr. 46 (datiert 1193). - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 186, Nr. 1791 (aus dem Jahr 1193).
Datierung
Es wird davon ausgegangen, dass der im Erzbistum Trier verwendete Nachrichtenstil verwendet wurde, siehe Strubbe und Voet, Chronologie, 54.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht ohne weiteres ersichtlich.


Nummer 10
Dirk II., Herr von Valkenburg, schenkt dem Verwalter und dem Konvent des Klosters Sint-Gerlach in Houthem neun "bunder" (= 7,2 ha) Land in Hatersbruc und vier "bunder" (= 3,2 ha) seines freien Grundbesitzes in Houthem sowie eine "cijns" (Zins oder Steuer) von fünfzehn Lütticher Schilling. Das Kloster war ihm diese Zahlung aufgrund einer früheren Schenkung von vier Mark schuldig. Dirk legt auch fest, dass das Kloster verpflichtet ist, von diesen Spenden jedes Jahr eine Mark für den Gedenkgottesdienst am Todestag seiner Frau Berta zu verwenden und drei Mark für die immerwährende Feier einer täglichen Messe für die Verstorbenen.
Dirk II., Herr von Valkenburg, schenkt der Propstei und dem Kloster Sint-Gerlach neun Morgen Land in Hatersbruc, vier in seinem Allodium in Houthem und eine Steuer von fünfzehn Lütticher Schilling, die das Kloster ihm für eine frühere Schenkung von vier Mark schuldete. Außerdem bestimmte er, daß das Kloster davon jährlich eine Mark für die Pitanz am Jahrestag seiner Frau Berta und drei Mark für die ewige Feier einer täglichen Messe für die Verstorbene bereitstellen musste.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 152, Reg. Nr. 9. Gefüttert.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1° von der Hand aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts: Littera de IX bonuaria terre et de IIII bonuaria etcetera. - 2° von der Hand aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts: L j. - 3° von der Hand des 17. Jahrhunderts: 1254. - 4° von der Hand des 18. Jahrhunderts: Num. 70
Siegel: drei hängend befestigte, doppelt durchstochene Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Dirk II, Herr van Valkenburg, aus braunem Wachs, beschädigt, mit CS1, beschädigt. - S2 von Engelbert (van Valkenburg), Erzdiakon von Lüttich, aus grünem Wachs, beschädigt. - S3 von Alard van Haasdal, Ritter, aus braunem Wachs, makellos; und zwei Befestigungen, vermutlich für die angekündigten Siegel von Gozewijn Dukere, Ritter, und Adam van Borgharen, Ritter, (SD4 und SD5). Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, S2 und S3 siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 158, 150-151 bzw. 160.
Kopie
B. 1736, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 115-116, unter der Überschrift: Littere Theodorici, domini de Valckenburgh, de novem bonnariis terre et quatuor (korrigiert aus anderen Briefen) iacentibus in Hatersbruc et in Holtheijm, und am Rande: Num. 70, unter Angabe von fünf Siegelstellen, an A.
Ausgabe
a. Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 12-13, Nr. 8, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar von Sint-Gerlach, 70-71, Reg. Nr. 9. - Idem, Chronologisches Verzeichnis, 48, Reg. Nr. 102.
Herkunft
Die Schreiberhand der vorliegenden Urkunde hat Ähnlichkeit mit derjenigen einer Maastrichter Schöffenurkunde aus dem Jahr 1254, in der es um einen Streit zwischen der Propstei und dem Konvent von Sint-Gerlach geht, sowie mit der Hand, die vier Jahre später zwei Urkunden für das Kloster Sint-Gerlach (ins reine) schrieb, siehe unten Nr. 9, 13 und 14. Diese Originale weisen auch eine identische charakteristische Formatierung auf: Der Schreiber hat den Urkundentext nicht auf den aufgetragenen Linierung geschrieben , sondern weit über diese Zeilen .
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.

Nummer 10
Hildegonde, Äbtissin, und das Kapitel Unserer Lieben Frau von Thorn übertragen einstimmig den Zehnten von Hemert und die Einkünfte von Avezaath in ewiger Pacht an Abt und Konvent der Sint-Paulus Abtei in Utrecht gegen eine jährliche Pacht, die am 1. Mai in der Kirche von Thorn zu entrichten ist. Außerdem erhält der Abt von der Äbtissin von Thorn die Kirche von Hemert mit dem Zehnten, ihren eigenen Gütern und den anderen Einkünften, die jetzt der Pfarrei gehören.
Hildegonde, Äbtissin, und das Kapitel Unserer Lieben Frau von Thorn gewähren dem Abt und dem Konvent der Abtei Sint-Paulus in Utrecht den Zehnten von Hemert und die Einkünfte von Avezaath gegen einen jährlichen ewigen Pachtzins von sechs Mark Kölnisch und legen fest, daß der Abt der Abtei Sint-Paulus nach dem Tod des Pfarrers von Hemert die Einkünfte der Abtei besitzen wird.
Original
[A]. Nicht vorhanden, aber bekannt aus B.
Kopie
B. 1269 März 25, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv. Nr. 16, Vidimus von Amelis, Dekan, und Steven, Dekan der Kirche St. Peter in Utrecht, an [A].
Ausgabe
a. Heeringa, OSU II, 312-313, Nr. 909, nach B.
Kohärenz
Für das Vidimus des Domdekans und des Dekans der Sintt. Pieterkirche in Utrecht vom 25. März 1269, siehe Sammlung Thorn, Nr. 29.


Nummer 10
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de overbrenging van de kloosterzusters vanuit de abdij Kloosterrade en vanuit Scharn naar Sinnich, de dotatie van een nieuw vrouwenconvent aldaar met goederen die evenwel eigendom van de abdij blijven, alsmede de onderhorigheid van dat convent aan de abdij.>
<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de overbrenging van de kloosterzusters vanuit de abdij Kloosterrade en vanuit Scharn naar Sinnich, de dotatie van een nieuw vrouwenconvent aldaar met goederen die evenwel eigendom van de abdij blijven, alsmede de onderhorigheid van dat convent aan de abdij.>
Scheinbar original
<A>. Maastricht, HCL, toegangsnr. 14.D004, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1700.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 56-60, Nr. 20, nach A.
Authentizität
Diese Charta ist zweifelsohne eine Fälschung und entstand vier oder fünf Jahrhunderte später, siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.
Textausgabe
Die häufige Verwendung des übergeordneten o auf u oder v wurde nicht übernommen.


Nummer 10
Kaiser Friedrich II. nimmt die Sint-Servaaskirche in Maastricht unter seinen Schutz und bestätigt alle von seinen Vorgängern gewährten Privilegien.
Kaiser Friedrich II. nimmt die Sint-Servaaskirche in Maastricht unter seinen Schutz und bestätigt alle von seinen Vorgängern gewährten Privilegien.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 47. Beschädigt, ohne Verlust des Textes.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Kaiser Friedrich II, aus braunem Wachs, makellos. Für eine Beschreibung und Abbildung des Siegels, siehe Venner, "Zegels", Nr. 44.
Abschriften
B. 1273 November 1, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 54, Einschub in eine Urkunde des römischen Königs Rudolf I., nach A. - C. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 10r-11r (= neues fol. 27r-28r), Nr. 18, nach B.
Ausgaben
a. Koch, Die Urkunden Friedrichs II., 284-286, Nr. 313, nach A. - b. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 309-310, Nr. 96a (unvollständig), nach A. - DiBe ID 15320, nach a.
Zusammenfassungen
Siehe Koch, Die Urkunden Friedrichs II., 285, und DiBe ID 15320.
Ursprung und Kohärenz
In der vorliegenden Charta sind Teile des Textes der Charta Heinrichs V. von 1109 entnommen, siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 3. Für Teile des Textes, die dieser Vorurkunde entnommen und in kleinerer Schrift gedruckt wurden, siehe Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 76. Dies ist auch die Vorurkunde zur Charta des römischen Königs Heinrich VII. vom 9. Mai 1222, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 12. Die vorliegende Urkunde ist auch in der Urkunde des römischen Königs Rudolf I. vom 1. November 1273 enthalten, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 36. Nach Koch, Die Urkunden Friedrichs II., 285, ist der Schreiber der vorliegenden Urkunde nicht bekannt, doch kann das Diktat einem anonymen Schreiber aus der kaiserlichen Kanzlei, Anonymus J., zugeschrieben werden.

Nummer 11
Wolter, Oberer der Minderbrüder in Maastricht, stellt eine Urkunde über ein Vermächtnis des Ritters Gerard von Scherwier an den Ritter Adam von Nuth aus, in der es um die Zahlung von 30 Mark aus unrechtmäßig erworbenem Besitz geht.
Wolter, Propst der Minderbrüder in Maastricht, stellt eine Urkunde über das unrechtmäßig erworbene Eigentum von Gerard van Scherwier, Ritter, anlässlich seiner Schenkung von 30 Mark aus, die ihm Adam van Nuth, Ritter, schuldete. (Deperditum)
Original
Nicht verfügbar.
Kopie
Nicht verfügbar.
Erwähnung
Diese Urkunde ist bekannt aus der Dispositio einer Urkunde von Gerard von Scherwier, Ritter, siehe infra Nr. 12, wo die vorliegende Urkunde erwähnt wird: "Der König der Niederlande ist der König der Niederlande". 12, wo diese Urkunde erwähnt wird: sub tali forma quod si bona mea iniuste acquisita, que plenius invenientur in litera quam Wolterus, gardianus Traiectensis, super ordinationem mee legationis conscripsit de triginta marcis quasAdam, miles, de Nutte debet mihi, persolvi enim poterunt de proventibus fructuum terre prenominate, persolvuntur de anno in annum quoadusque secundum tenorem dicte litere competenter fuerint persoluta.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.


Nummer 11
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn haben aus Furcht vor untragbaren Zinsen einstimmig beschlossen, die Geldsumme, die sie jährlich Anfang Oktober von den Pächtern der Höfe von Baarle und Gilze erhalten, an Godfried, Herr von Breda, zu verkaufen. Sollte Godfrey den Erlös nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erhalten, wird er ihre Pfänder entgegennehmen und die Entschädigung nach dem Urteil der Schöffen einfordern. Robert, Bischof von Lüttich, und Heinrich, Herzog van Lotharingen und Brabant, genehmigen diesen Verkauf mit einer Urkunde.
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn verkaufen mit Erlaubnis des Bischofs von Lüttich und des Herzogs von Brabant an Godfied IV, Herr van Breda, fünf Mark Kölnisch von den Cijns, die die Pächter der Höfe von Baarle und Gilze jährlich der Abtei schulden.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, prel. inv. Nr. 2218.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 262-264, Nr. 995, nach A.


Nummer 11
Heinrich II., Bischof von Lüttich, bestätigt die Schenkung der Kirche von Lommersum mit der gesamten dos, familia und den Zehnten durch die Nachkommen von Jutta, der Ehefrau des Herzogs Walram II. van Limburg, an die Abtei Kloosterrade, die Jutta bei ihrem Eintritt in die Abtei übertragen hatte.
Heinrich II., Bischof von Lüttich, bestätigt die Schenkung der Kirche von Lommersum mit der gesamten dos, familia und den Zehnten durch die Nachkommen von Jutta, der Ehefrau des Herzogs Walram II. van Limburg, an die Abtei Kloosterrade, die Jutta bei ihrem Eintritt in die Abtei übertragen hatte.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 802, 1.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 60-63, Nr. 21, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 11
Otto (van Everstein), Propst des Aachener Liebfrauenkapitels und des Sint-Servaaakapitels in Maastricht, schenkt dem Sint-Servaaskapitel das Patronatsrecht über die Sint-Janskirche in Maastricht.
Otto (van Everstein), Propst des Aachener Liebfrauenkapitels und des Sint-Servaaakapitels in Maastricht, schenkt dem Sint-Servaaskapitel das Patronatsrecht über die Sint-Janskirche in Maastricht.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 816.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: De ecclesia Sancti Iohannis. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 1218 / g II. - 3o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: [***] dedit [***]. - 4o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: In capsula fab[rice] excopiata numero 7. - 5ovon einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: 1218 mense iulio. - 6o von einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: 16.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Otto, Propst des Liebfrauenkapitels in Aachen und des Sint-Servaaskapitels in Maastricht, aus braunem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Zegels", Nr. 30.
Abschriften
B. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (Kartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 16v (= neues fol. 33v), Nr. 24, nach A. - C. 1640, Ibidem, idem, Inv. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, p. 27, unter der Überschrift: 21, Otto, prepositus, declarat ecclesiam Sancti Ioannis spectare ad capitulum, nach A. - D. 17. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 95r, unter der Überschrift: [Otto, prepositus, cedit ius patronatus ecclesie de Sancti Iohannis Baptiste anno 1218, vide folio 93, möglicherweise nach A. - [E]. nicht vorhanden, aber bekannt aus F, Cartularium van het Sint-Servaaskapittel in Maastricht = Liber A, fol. 68v. - F. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartularium) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, S. 236, unter der Überschrift: Otto, prepositus Sancti Servatii confert capitulo libere et absolute ius patronatus ecclesie Sancti Ioannis Baptiste in Traiecto, 8. Juli 1210, nach [E].- G. vor 1768, Ibidem, idem, fol. 248, unter der Überschrift: Otto, prepositus Sancti Servatii declarat ecclesiam Sancti Ioannis spectare ad capitulum Sancti Servatii, mense iulii 1218.
Ausgabe
a. Teichmann, ˈAachen', 106, Nr. 1, nach A.
Zusammenfassungen
Willemsen, "Inventaire", 167, Nr. 6. - De Borman, "Notice", 28. - Habets, "Codex diplomaticus", 37, Nr. 52. - Wauters, Table chronologiquel III, 681. - Doppler, "Verzameling", 263, Nr. 76. - Haas, Chronologische lijst, 35, Nr. 57. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 149, Nr. 816. - DiBe ID 15962.
Kohärenz
Aus einer undatierten Urkunde geht hervor, dass die Schenkung des Patronatsrechts durch Otto van Everstein erfolgte mit Zustimmung des römischen Königs Friedrich, der sie in einer königlichen Urkunde vom 26. Dezember 1218 bestätigte (siehe Doppler, "Verzameling", 263-264, Nr. 77 (datiert vor dem 26. Dezember 1218), und Idem, "Verzameling", 264, Nr. 78). In einer ebenfalls undatierten Urkunde bestätigt Engelbert van Berg, Erzbischof von Köln, diese Übertragung durch Kaiser Friedrich II, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 13. Für die Urkunde des römischen Königs Heinrich VII. vom 9. Mai 1222, in der er das Sint-Servaaskapitel in seinen Schutz nimmt, alle seine Privilegien bestätigt und die Verleihung des Patronatsrechts durch Otto van Everstein ratifiziert, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 12.

Nummer 12
Ritter Gerard van Scherwier, schenkt dem Kloster Sint-Gerlach in Houthem ein halbes Gehöft mit Ackerland aus seinem freien Grundbesitz zwischen Swier und Laar. Diese Schenkung erfolgt unter der Bedingung, dass damit eine Schuld von 30 Mark getilgt wird. Der Konvent Sint-Gerlach wird nach der Rückzahlung ungestört die Hälfte des Hofes besitzen, unter der Bedingung, dass der Konvent für immer und ewig am Jahrestag seines Todes den Gedenkgottesdienst für seine Frau Agnes und seine Eltern abhalten wird, Messen lesen und eine Weinbewirtung zahlen wird.
Gerard van Scherwier, Ritter, schenkt dem Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) ein halbes Gehöft mit Ackerland aus seinem Allodium (lehensfreier Grundbesitz) zwischen Swier und Laar unter der Bedingung, daß davon eine Schuld von 30 Mark getilgt wird und daß das Kloster ihm, seiner Frau Agnes und seinen Eltern auf ewig die Jahrzeitmesse hält, Messen feiert und eine Pitanz zahlt.
Original
[A]. Nicht vorhanden, dargestellt durch B, versiegelt mit zwei Siegeln.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 188-189, Nr. 126, unter der Rubrik: Anniversarium Gerardi de Scherwire, und am Rande: Num. 126, unter Angabe von zwei Siegelstellen, zu [A].
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Kohärenz
Die vorliegende Urkunde erwähnt eine Urkunde von Wolter, Gardian der Franziskaner in Maastricht, über die unrechtmäßig erworbenen Güter von Gerard van Scherwier, Ritter: si bona mea iniuste acquisita, que plenius invenientur in litera quam Wolterus, gardianus Traiectensis, super ordinationem mee legationis conscripsit. Für dieses Deperditum, siehe infra Nr.11.


Nummer 12
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn vereinbaren eine gegenseitige Aufteilung der Güter und Einkünfte in Thorn, Bocholt, Baexem, Cobbenhese, Neer, Avezaath, Hemert, Eisden, Bergeijk, Übach, Wessem, Leveroy, Dasselre, Beersel, Rode, Ell, Haler, Oeteren, Gilze, Baarle und Grathem.
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn vereinbaren eine gegenseitige Aufteilung der Güter und Einkünfte in Thorn, Bocholt, Baexem, Cobbenhese, Neer, Avezaath, Hemert, Eisden, Bergeijk, Übach, Wessem, Leveroy, Dasselre, Beersel, Rode, Ell, Haler, Oeteren, Gilze, Baarle und Grathem.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 20.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 264-266, Nr. 996, nach A.


Nummer 12
Friedrich II., Erzbischof von Köln, bestätigt die Schenkung der Kirche zu Lommersum mit der gesamten dos, familia und dem Zehnten durch die Nachkommen Juttas, der Gemahlin des Herzogs Walram II. von Limburg, an die Abtei Kloosterrade, die Jutta bei ihrem Eintritt in die Abtei der Abtei übertragen hatte; im Anschluss an Erzbischof Arnold I. bestätigt er der Abtei auch den Besitz mehrerer namentlich genannter Güter.
Friedrich II., Erzbischof von Köln, bestätigt die Schenkung der Kirche zu Lommersum mit der gesamten dos, der familia und den Zehnten durch die Nachkommen Juttas, der Gemahlin des Herzogs Walram II. von Limburg, an die Abtei Kloosterrade, die Jutta bei ihrem Eintritt in die Abtei der Abtei übertragen hatte; im Anschluss an Erzbischof Arnold I. bestätigt er der Abtei auch den Besitz mehrerer namentlich genannter Güter.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 802, 2.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 73-76, Nr. 29, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.
Textausgabe
Einige Wörter in der Datumszeile landeten unter dem gedruckten Siegel. Für den Nachtrag siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 12
Der römische König Heinrich VII. nimmt die Sint-Servaaskirche in Maastricht unter seinen Schutz, bestätigt die von seinen Vorgängern gewährten Privilegien sowie die Schenkung des Patronatsrechts der Sint-Janskirche in Maastricht an das Sint-Servaaskapitel durch (Otto), Propst (des Onze-Liev-Vrouwkapitels in) Aachen und das Sint-Servaakapitel in Maastricht.
Der römische König Heinrich VII. nimmt die Sint-Servaaskirche in Maastricht unter seinen Schutz, bestätigt die von seinen Vorgängern gewährten Privilegien sowie die Schenkung des Patronatsrechts der Sint-Janskirche in Maastricht an das Sint-Servaaskapitel durch (Otto), Propst (des Onze-Liev-Vrouwkapitels in) Aachen und das Sint-Servaakapitel in Maastricht.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 17. Liniiert. Beschädigt mit Verlust von Text.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: Henrici VII regis. - 2ovon einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Carta de officatis ecclesie. - 3ovon einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: XII durchgestrichen. - 4o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Anno 1222. - 5o von einer Hand des 16. Jahrhunderts: R. M I n. - 6o von einer Hand des 17. Jahrhunderts: In capsula imperialium. - 7o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: 25 E I (verbessert von 25 d I). -8o von einer Hand des 18. Jahrhunderts: De confirmatione privilegiorum etc., immunitate officiatorum ab exactione iure forensi et civili, a teloneo in omni distructu imperii et cessione per dictum prepositum capitulo factus ad usus eorum super parochia sancti Iohannis.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 des römischen Königs Heinrich VII, beschädigt, aus weißem Wachs. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Zegels", Nr. 46.
Abschriften
B. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (Kartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 7r-7v (neu fol. 24r-24v), Nr. 12, nach A. - C. 1640, Ibidem, idem, Inv. Nr. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, S. 74-75, unter der Überschrift: Henricus septimus, imperator, confirmat privilegia ecclesie et maxime quoad libertatem supportatam ab omni exactione, zu A. - D. 17. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 12 (cartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (also) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 25v-27r, unter caput: Imperialia, und unter der Überschrift: Confirmatio privilegiorum, libertatum usw., specialiter quod officales et ministri ecclesie ab omni iure civili et forensi et omni exactione sint liberi, etiamsi sint mercatores; item libertas thelonii, später, um 1757, beglaubigt durch Membrede, Kapitelsekretär und öffentlicher Notar, nach A. - [E]. nicht verfügbar, aber bekannt aus F, Kartular des Sint-Servaaskapitels in Maastricht = Liber A, fol. 204. - F. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartular) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, S. 272-273, unter der Überschrift: Hendricus septimus, Romanorum rex, confirmat privilegia Sancti Servatii tam exemptionum talliarum quam accysiarum eorum qui in claustris morantur, hac 7 idus maii 1222, beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, nach A.
Ausgaben
a. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica II-2, 738-740, nach einer Abschrift in einem Kartular des Sint-Servaaskapitels in Maastricht (in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin). - b. De Borman, "Notice", 31-33, nach B. - c. Sloet, OGZ I, 471, Nr. 467 (unvollständig), nach A. - d. DiBe ID 16799, nach a.
Zusammenfassungen
Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires, 53. - Wauters, Table chronologique III, 687. - Böhmer und Ficker, Regesta imperii V-2, 703, Nr. 3877. - Knipping, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln III, 63, Nr. 356. - Doppler, "Verzameling", 270-271, Nr. 94. - Heeringa, OSU II, 152, Nr. 702. - Haas, Chronologische lijst, 36, Nr. 59. - Böhmer und Zinsmaier, Regesta imperiiV-4, 244. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas 49, Nr. 17.
Zusammenhang und Textausgabe
Der Text der vorliegenden Urkunde ist der Urkunde Kaiser Friedrichs II. vom 28. Juli 1215 entnommen, siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 10. Für Teile des Textes, die dieser Vorurkunde entnommen und in kleinerer Schrift gedruckt wurden, siehe Van Synghel, Oorkonden Sint-Servaasapittel, 84. Wo ein oder mehrere Wörter in der Nachurkunde nicht übernommen wurden, wurde ein Sternchen gesetzt.
Für die Schenkungsurkunde von Otto, Propst des Aachener Liebfrauenkapitels und des Maastrichter Ssint-Servaas-Kapitels, datiert Juli 1218 , siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 11, und die dortige Verbindung. Für die Bestätigung durch den römischen König Rudolf I., datiert auf den 1. November 1273, mit Einfügung der vorliegenden Charta, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 36. Die Lücke in A wurde in B eingefügt. Die Unterschied zwischen c und t ist schwer zu erkennen.


Nummer 13
Jan,Verwalter, und der Konvent des Klosters Sint-Gerlach in Houthem geben bekannt, dass der Konvent die für das Refektorium (Speisesaal) bestimmten Güter und die Einnahmen aus den Bewirtungen, die der Verwalter jährlich bei den Gedenkgottesdiensten am Jahrestag eines Todes aus dem zum Kloster gehörenden Bauernhof gewährt, dem Verwalter zugunsten des gesamten Konvents schenkt. Der Verwalter überträgt seinerseits die Güter in Heek unter Klimmen an das Kloster.
Johannes, Propst, und der Konvent des Klosters Sint-Gerlach (in Houthem) verkünden, daß der Konvent dem Propst die für das Refektorium bestimmten Güter und die Einkünfte aus den Pfründen, die der Propst jährlich an den Jahrestagen aus dem Klostergutshof gewährt, zugunsten des gesamten Konvents schenkt, wobei der Propst seinerseits die Güter in Heek unter Klimmen dem Konvent zuweist.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 52, Reg. Nr. 10. Gefüttert.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: De Heick, 1257. -2ovon der Hand des 18. Jahrhunderts: Num. 79, 1257.
Siegel: zwei Befestigungsstellen mit nur zwei sichtbaren Schnitten in der Plika, vermutlich für die angekündigten Siegel der Urkunden (LS1 und LS2).
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 125-126, unter der Überschrift: Divisio redituum inter prepositum et conventum ecclesie sancti Gerlaci, und am Rande: Num. 79, unter Angabe von zwei Siegelstellen, zu A.
Ausgabe
a. Franquinet, Aufgezeichnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 13-14, Nr. 9 (datiert 1257 Februar), nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar von Sint-Gerlach, 71, Reg. Nr. 10 (datiert 1257 Februar). - Idem, Chronologische Liste, 50-51, Reg. Nr. 109 (datiert 1257 Februar).
Datierung
Die Verwendung des Osterstils in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII.
Herkunft
Diese Urkunde wurde von derselben Hand geschrieben, die einige Monate später die Urkunde von Adam van Amby zugunsten des Klosters Sint-Gerlach schrieb, siehe infra Nr. 14. Diese Hand ist auch eng mit der Hand des Schreibers verwandt, der 1254 eine Urkunde für den Herrn van Valkenburg und eine Schöffenurkunde von Maastricht über einen Streit mit der Propstei und dem Konvent schrieb: Sint-Gerlach , 9, 10, 13 und 14. Diese Originale weisen auch dieselbe charakteristische Formatierung auf: Der Schreiber hat den Urkundentext nicht auf die angebrachte Linierung geschrieben, sondern weit über diese Zeilen.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 13
Elisabeth, eine körperlich und geistig gesunde Nonne der Abtei Thorn, vermacht der Abtei Thorn, unter Vorbehalt ihres Nießbrauchs, alle ihre Güter, Einkünfte und Besitztümer in Wessem, Thorn, Ittervoort, Grathem und Heeze, die sie rechtmäßig durch Kauf erworben hat und die unter der Kirche von Thorn ressortieren. Von den Erträgen geht ein jährlicher Betrag an den Bediener des Katharinenaltars in der Krypta der Kirche von Thorn. Die übrigen Einnahmen sind für Äbtissin, Konvent und Kanoniker bestimmt, mit der Verpflichtung, an Elisabeths Todestag einen Betrag an die Armen zu verteilen. Außerdem dürfen Äbtissin, Konvent und Kanoniker eine Summe, die aus dem Kauf eines an Horn angrenzenden Grundstücks stammt, zu gleichen Teilen unter sich verteilen.
Elisabeth, Klosterfrauvon Thorn, vermacht, vorbehaltlich ihres Nießbrauchs, der Kirche von Thorn und dem Altar Unserer Lieben Frau alle ihre Güter, Lehen und die Einkünfte aus den in Wessem, Thorn, Heeze und auf den Mühlen von Ittervoort und Grathem erworbenen Zöllen. Davon sind acht Pfund Leuvens jährlich für den Priester des Katharinenaltars in der Kirche von Thorn bestimmt; der Rest wird der Äbtissin, dem Konvent und den Chorherren zugewiesen mit der Verpflichtung, an ihrem Todestag zwölf Lütticher Pfennige an die Armen zu verteilen. Außerdem vermacht Elisabeth nach ihrem Tod sechs Lütticher Mark , die Hildegonde und ihr Mann Cono ihr schulden fürden Kauf eines Grundstücks in der Gegend von Horn, das zu gleichen Teilen unter Äbtissin, Konvent und Chorherren aufgeteilt werden soll.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 23.
Ausgabe
a. Camps, ONB I, 324-325, Nr. 245, nach A.
Kohärenz
Die vorliegende Urkunde ist die Vorrede zur Urkunde von N. de Maceriis, Kanoniker des Johanneskapitels in Lüttich und Offizial von Lüttich, datiert 1252.04.08 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 14). Diese Urkunden lassen keine schreiberische Beziehung erkennen.


Nummer 13
Alexander, Propst des Sint-Lambertuskapitels in Lüttich und Archidiakon, teilt den Kanonikern dieses Kapitels, die in Visé residieren, mit, dass Erpo, Abt von Kloosterrade, das Land, für das Udo van Visé und seine Erben die Akzise an die Kirche Sint- Peter in Warsage zu entrichten hatten, von Hendrik van Dongelberg, Pfarrer dieser Kirche, gegen Zahlung der jährlichen Steuerabgabe bei jeder Ernennung eines neuen Abtes erworben hat.
Alexander, Propst des Sint-Lambertuskapitels in Lüttich und Archidiakon, teilt den Kanonikern dieses Kapitels, die in Visé residieren, mit, dass Erpo, Abt von Kloosterrade, das Land, für das Udo van Visé und seine Erben die Akzise an die Kirche Sint- Peter in Warsage zu entrichten hatten, von Hendrik van Dongelberg, Pfarrer dieser Kirche, gegen Zahlung der jährlichen Steuerabgabe bei jeder Ernennung eines neuen Abtes erworben hat.
Originale
A1. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv. Nr. 823, Chirographie, bestimmt für die Abtei, die den Fundort angibt.
[A2]. Nicht verfügbar, Chirograph, für die Gegenpartei bestimmt.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 80-81, Nr. 33, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 13
Engelbert (van Berg), Erzbischof von Köln, teilt mit, dass sein Verwandter Otto, Propst des Sint-Servaaskapitels in Maastricht, mit Erlaubnis Kaiser Friedrichs II. die Sint-Janskirche in Maastricht den Brüdern der Sint-Servaaskirche geschenkt hat, und billigt diese Schenkung mit Zustimmung von Hugo, Bischof von Lüttich.
Engelbert (van Berg), Erzbischof von Köln, teilt mit, dass sein Verwandter Otto, Propst des Sint-Servaaskapitels in Maastricht, mit Erlaubnis Kaiser Friedrichs II. die Sint-Janskirche in Maastricht den Brüdern der Sint-Servaaskirche geschenkt hat, und billigt diese Schenkung mit Zustimmung von Hugo, Bischof von Lüttich.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 817.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand des 15. Jahrhunderts: De ecclesia Sancti IohannisBaptiste, und von späterer Hand hinzugefügt: approbatio archiepiscopi Coloniensis/ XXII. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: R. M II. -3o von einer Hand des 17. Jahrhunderts: In capsula episcoporum. - 4o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: approbatio nu. Io.
Siegel: eine Befestigungsstelle für das angekündigte Siegel des Engelbert van Berg, Erzbischof von Köln, das nicht vorhanden ist (SD1).
Abschriften
B. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archie Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (Kartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 17 (neues fol. 34r), Nr. 26, nach A. - C. 1640, Ibidem, idem, Inv. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, S. 28, unter der Überschrift: Confirmat idem archiepiscopus Coloniensis, nach A.
Ausgaben
a. De Borman, "Notice", 29 (undatiert), an B. - b. DiBe ID 16082, an a.
Zusammenfassungen
Habets, "Codex diplomaticus", 37, Nr. 53. - Wauters, Table chronologique III, 682 (datiert um 1218). - Knipping, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln III, 84, Nr. 523 (datiert 1221-1225). - Doppler, "Verzameling", 267, Nr. 86. - Haas, Chronologische lijst, 35-36, Nr. 58 (datiert s.d. (1220-1225)). - Nuyens, Inventaris Sint Servaas, 150, Nr. 817.
Kohärenz
Siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 11.
Datierung
Der terminus post quem dieser undatierten Urkunde ist die Kaiserkrönung Friedrichs am 22. November 1220 (Grotefend, Taschenbuch, 113). Der terminus ante quem ist das Todesdatum von Erzbischof Engelbert van Berg, der am 7. November 1225 ermordet wurde.


Nummer 14
Adam van Amby, Ritter, überträgt mit Zustimmung seiner Kinder Jan, Waltelm, Agnes und Catharina ein Gehöft mit Ackerland im Gebiet von Borgharen an den Verwalter und Konvent des Klosters Sint-Gerlach in Houthem. Ritter Adam legt auch fest, dass seine Nachkommen, die diesen Hof nach der Übertragung weiter nutzen und dafür "cijns" (Steuer) zahlen sollen, einen jährlichen Erbzins von zwei Mark Kölnisch schulden. Diesen müssen sie bei der Gedenkfeier am Jahrestag seines Todes zahlen. Wenn seine Nachkommen diese Schulden nicht leisten, können der Verwalter und der Konvent das Ackerland in Besitz nehmen, bis sie für den entstandenen Schaden entschädigt worden sind. Dies wird von Dirk II., dem Herrn von Valkenburg, zu Gunsten des Verwalters und des Klosters kontrolliert.
Adam van Amby, Ritter, überträgt mit Zustimmung seiner Kinder Jan, Waltelm, Agnes und Catharina ein Gehöft mit Ackerland im Gebiet von Borgharen an die Propstei und den Konvent des Klosters Sint-Gerlach (in Houthem) und bestimmt, daß seine Nachkommen, die dieses Gehöft nach seinem Tod nach cijnsrecht innehaben, mit der Zahlung einer jährlichen Erbsteuer von zwei Mark Kölnisch - immer an seinem Todestag - beauftragt werden. Sollten sie dies nicht tun, dürfen Propst und Konvent das Land in Besitz nehmen und dieses wird von Dirk II, Herrn van Valkenburg, beaufsichtigt.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 153, Reg. Nr. 11. Gefüttert.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1° von der Hand des 13. Jahrhunderts: Bona de Haren. - 2°von der Hand des letzten Viertels des 14. Jahrhunderts: M. - 3° von der Hand des 16. Jahrhunderts: [***] sanctiGerlaci, 1258.
Siegel: zwei doppelt durchstochene, hängend befestigte Siegel, angekündigt, nämlich: S2 von Engelbert (van Valkenburg), Erzdiakon von Lüttich, aus weißem Wachs, beschädigt. - S3 von Alard van Haasdal, Ritter, aus weißem Wachs, beschädigt; und zwei Befestigungsstellen vermutlich für die angekündigten Siegel von Dirk II, Herr van Valkenburg, und Adam van Borgharen, Ritter, (LS1 und LS4). Für eine Beschreibung und Abbildung von S2 und S3, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 150-151 bzw. 160.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 128-129, unter der Überschrift: Donatio Ade de Ambiie, militis, de uno manso terre arabilis in territorio de Haren, und am Rande: Num. 82, unter Angabe von vier Siegelstellen, an A.
Ausgabe
a. Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 14-16, Nr. 10, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 71, Reg.-Nr. 11. - Idem, Chronologische Liste, 51, Reg.-Nr. 112.
Datierung
Die Verwendung des Osterstils in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII.
Herkunft
Diese Urkunde wurde von derselben Hand geschrieben, die einige Monate zuvor die Urkunde der Propstei und des Konvents des Klosters Sint-Gerlach prägte, siehe infra Nr. 13. Diese Hand ist auch eng mit der Schreiberhand verwandt, die 1254 eine Urkunde für den Herrn van Valkenburg und eine Schöffenurkunde von Maastricht über einen Streit mit der Propstei und dem Konvent von Sint-Gerlach verfaßte, siehe infra Nr. 9, 10, 13 und 14. Diese Originale weisen auch dieselbe identische charakteristische Formatierung auf: Der Schreiber hat den Urkundentext nicht auf die aufgetragene Linierung geschrieben, sondern weit darüber.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 14
N. de Maceriis, Kanoniker des Johanniskapitels in Lüttich und Offizial von Lüttich, teilt mit, daß Elisabeth, Nonne der Abtei Thorn, in seiner Gegenwart ihr Testament gemacht hat, in dem sie, unter Vorbehalt ihres Nießbrauchs, alle ihre Güter, Einkünfte und Besitztümer der Abtei Thorn geschenkt und deren Verteilung zwischen Äbtissin, Konvent und Kanonikern festgelegt hat.
N. de Maceriis, Kanoniker des Sint-Jankapitels in Lüttich und Offizial von Lüttich, teilt mit, daß Elisabeth, Nonne des Klostersvon Thorn, alle ihre Güter, Lehen und die Einkünfte aus den Erträgen, die sie in Wessem, Thorn, Heeze und auf den Mühlen von Ittervoort und Grathem erworben hat, der Kirche von Thorn und dem Altar Unserer Lieben Frau vermacht hat. Davon sind acht Pfund Leuvens jährlich für den Priester des Katharinenaltars in der Kirche von Thorn bestimmt; der Rest wird der Äbtissin, dem Konvent und den Kanonikern zur Verteilung von zwölf Lütticher Pfennig an die Armen an ihrem jährlichen Todestag zugewiesen. Elisabeth vermacht auch, vorbehaltlich ihres Nießbrauchs nach ihrem Tod, sechs Lütticher Mark , die Hildegonde und ihr Mann Cono ihr schulden fürden Kauf eines Grundstücks in der Gegend von Horn, das zu gleichen Teilen unter Äbtissin, Konvent und Kanonikern aufgeteilt werden soll.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 24.
Anmerkungen auf der Vorderseite: 1ovon einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: M CC LIIo. - Anmerkung auf der Rückseite: 1ovon der Hand des13./14. Jahrhunderts: De altari sancte Katherine. - 2ovon einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: In Thoren, in cripta, 1252. - 3o von einer Hand ausdem 17. Jahrhundert: F.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel angekündigt, nämlich: S1 von der Behörde von Lüttich, aus grünem Wachs, stark beschädigt.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Zusammenfassungen
Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 18-19, Nr. 11. - Habets, Archiv Thorn, 19-20, Nr. 24. - Haas, Chronologisches Verzeichnis, 47, Nr. 97.
Ursprung und Kohärenz
Diese Urkunde basiert auf der Urkunde von Elisabeth, Klosterfrauvon Thorn, vom 7. April 1252 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 13). Zu den Textabschnitten in der vorliegenden Nachcharta die von der Vorcharta abgeleitet und in kleinerer Schrift gedruckt sind, siehe Van Synghel, Oorkonden Thorn, 54. Diese Urkunden weisen keine schriftstellerische Beziehung auf.


Nummer 14
Erpo, Abt von Kloosterrade, verkündet die Vereinbarung, dass Reimar, Dekan des Kapitels von Wissel, für 80 Mark einen Hof in Linzenich und das Lehen Gunthers zugunsten der Abtei Kloosterrade kauft, unter der Bedingung, dass die Abtei ihm zu Lebzeiten zweimal jährlich vier Mark zahlt und ihn nach seinem Tod in die Gebetsbruderschaft aufnimmt und sein Jahrgedächtnis feiert.
Erpo, Abt von Kloosterrade, verkündete die Abmachung, dass Reimar, Dekan des Kapitels von Wissel, zugunsten der Abtei Kloosterrade für 80 Mark ein Gehöft in Linzenich und das Lehen Gunthers kauft, unter der Bedingung, dass die Abtei ihm zu Lebzeiten zweimal jährlich vier Mark zahlt und ihn nach seinem Tod in die Gebetsbruderschaft aufnimmt und jährlich sein Gedächtnis feiert.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 822.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 87-89, Nr. 37, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 14
Schulzen, Schöffen und Bürger von Maastricht versprechen, die Privilegien, Freiheiten und Rechte des Sint-Servaaskapitrls in Maasticht zu respektieren.
Schulzen, Schöffen und Bürger von Maastricht versprechen, die Privilegien, Freiheiten und Rechte des Sint-Servaaskapitrls in Maasticht zu respektieren.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 75. Unten links in der Plica befinden sich zwei Einkerbungen für den transfigierten Vidimus vom 25. September 1455, der in Kopie E erwähnt wird.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: VIIa / f IIII / De compositione inter ecclesiam et cives Traiectenses / XXXI. - 2o von Hand des 16. Jahrhunderts: R. M I n. - 3o von einer Hand des 16. Jahrhunderts: anno 1227 / g I 9 / M. - 4o von einer Hand des 17. Jahrhunderts: In capsula Traiectensis / In capsula Traiectensis. - 5o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: caps. 8 (unleserlich gemacht, verbessert in 24).-6o von einrt Hand des 17. Jahrhunderts: Excopiatum nu. 10, compositionum.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S2 der Brabanter Stadtgemeinde Maastricht, aus braunem Wachs, stark beschädigt; und eine Befestigungsstelle vermutlich für das angekündigte Siegel der Lütticher Stadtgemeinde Maastricht (LS1). Für eine Beschreibung und Abbildung von S2 siehe Venner, "Zegels", Nr. 57.
Abschriften
B. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 16r (= neues fol. 33r), Nr. 31, nach A. - [C]. 25. September 1455, nicht vorhanden, aber bekannt aus einem Exemplar in Ibidem, idem, Inv. Nr. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 8v-10r und fol. 39r-40v, Vidimus von Bartholomeus de Eijck, Dekan des Sint-Catharinakapitels in Eindhoven, früher von A. transkribiert, nach A. - D. 17. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 1r, unter der Überschrift: Magistratus Traiectensis promittit servare privilegia et libertates ecclesie Sancti Servatii, anno 1227, möglicherweise nach A. - [E]. nicht vorhanden, aber bekannt aus F, Cartularium Sint-Servaaskapittel in Maastricht = Liber A, fol. 981. - F. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartularium) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, S. 303, unter der Überschrift: Schulteti, scabini etc. Traiectenses promittunt quod in perpetuum observabunt privilegia et libertates ecclesie Sancti Servatii concessas, 3 maii 1227, beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, nach B.
Ausgaben
a. Schaepkens, "Emblěmes", 223, Nr. 1, nach A. - b. Wauters, De l'origine, 101, nach einer Abschrift im ARA in Brüssel (Registre des chartes déposées en 1498 et 1500, fol. 145). - c. De Borman, "Notice", 38-39, nach B. - d. Panhuysen, Studies Maastricht, 136-137, Nr. II, nach B. - e. Van de Kieft, "Recueil", 456-457, Nr. 35, nach B und nach einer Abschrift aus dem 15. Jahrhundert im ARA Brüssel. - f. DiBe, Nr. 18121, nach e.
Zusammenfassungen
Habets, "Codex diplomaticus", 40, Nr. 62. - Nelis, Diplôme suspect, 139, Nr. 12. - Wauters, Table chronologique IV, 43. - Doppler, 'Verzameling', 275-276, Nr. 105. - Haas, Chronologischee lijst 38, Nr. 66. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 56, Nr. 75.


Nummer 15
Marcelis, Pfarrer der Sankt-Johanneskirche in Maastricht, gibt bekannt, dass Gerard von Amby und seine Frau Hildegonde dem Zisterzienserkloster von Val-Dieu und dem Prämonstratenserkloster Sint-Gerlach in Houthem die Hälfte von einem "bunder" (0,4 ha) Ackerland im Dorf Berg schenken. Dieses Ackerland hängt vom Hof Meerssen ab. Nach dem Tod der beiden Stifter erben beide Klöster dieses Ackerland.
Marcelis, Pfarrer der Sint-Janskirche in Maastricht, beurkundet, daß seine Gemeindemitglieder, Gerard van Amby und seine Frau Hildegonde, der Abtei Val-Dieu und dem Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) einen halben Hektar Ackerland in der Nähe von Berg schenken, das dem Hof von Meerssen untersteht und das sie nach dem Tod der Schenker erben werden.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 30, Reg. Nr. 12.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von Hand aus dem 17. Jahrhundert: 1257. - 2°von der Handdes 18. Jahrhunderts: Num. 84.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Marcelis, Pfarrer der Sint-Janskirche in Maastricht, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 151.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erfffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 130, unter der Überschrift: Testimonium Marsilii, plebani, de legato dimidii bonnarii terre arabilis in confinio ville de Bergh, und am Rande: Num. 84, unter Angabe einer Siegelstelle, an A.
Ausgabe
a. Franquinet, Aufgezeichnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 16, Nr. 11, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar von St. Gerlach, 72, Reg. Nr. 12. - Idem, Chronologische Liste, 51-52, Reg. Nr. 113.


Nummer 15
Hildegonde, Äbtissin von Thorn, bittet Meister Reinier, Scholaster in Tongeren und Prokurator in geistlichen Angelegenheiten von Hendrik III., Bischof von Lüttich, um das Patronatsrecht der Kirchen von Gilze, Baarle und Geertruidenberg, das sie (in einer Urkunde) den Kanonikern und Nonnen von Thorn übertragen hat, vom Bischof von Lüttich bestätigen zu lassen. Sie überträgt das Patronatsrecht wegen des außerordentlichen Mangels an Einkünften der Kanoniker und Nonnen. Die Äbtissin bittet den Bischof auch darum, daß die Töchter der genannten Kirchen Halbkirchen sind, daß die Kanoniker und Ordensschwestern in diesen Kirchen Pfarrer ernennen, die dort persönlich wohnen und Gottesdienste halten sollen, und daß die Pfarrer von Gilze, Mertersem, Ginneken, Etten, Baarle, Meerle und Geertruidenberg ein angemessenes, festgelegtes Einkommen erhalten.
Hildegonde, Äbtissin von Thorn, bittet Meister Reinier, Scholaster in Tongeren und Prokurator in geistlichen Angelegenheiten von Heinrich III., Bischof von Lüttich, dafür zu sorgen, daß der Bischof ihre Schenkung des Patronats der Kirchen von Gilze, Baarle und Geertruidenberg an die Kanoniker und Nonnen von Thorn mit den darin festgelegten Bedingungen genehmigt.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, prel. inv. Nr. 2219.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 341-343, Nr. 1039, nach A.


Nummer 15
Gottfried III., Herzog von Lothringen, und seine Söhne Heinrich und Adelbert sowie Hendrik III. van Limburg schenken der Abtei Kloosterrade den Teil der Zehnten von Lommersum, den Kunisa, Tochter von Herman van Reifferscheid, von ihnen zu Lehen hatte und zugunsten der Abtei abtrat.
Gottfried III., Herzog von Lothringen, und seine Söhne Heinrich und Adelbert sowie Hendrik III. van Limburg schenken der Abtei Kloosterrade den Teil der Zehnten von Lommersum, den Kunisa, Tochter von Herman van Reifferscheid, von ihnen zu Lehen hatte und zugunsten der Abtei abtrat.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 803, 1.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 89-91, Nr. 38, nach A,
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 15
Kaiser Friedrich II. genehmigt die Verteilung der Gerichtshöfe durch Propst und Kapitel von Sint-Servaas in Maastricht und weist dem Propst die Gerichtshöfe von Mechelen und Tweebergen zu.
Kaiser Friedrich II. genehmigt die Verteilung der Gerichtshöfe durch Propst und Kapitel von Sint-Servaas in Maastricht und weist dem Propst die Gerichtshöfe von Mechelen und Tweebergen zu.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 926. Liniiert. Beschädigt mit Verlust von Text.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand des 15. Jahrhunderts: S. v / De separatione prepositi et ecclesie (im Folgenden von späterer Hand ergänzt) facta perFredericum,Romanorum imperatorem. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Anno 1232 / 316. - 3o von einer Hand des 17. Jahrhunderts: 5 capsula secunda. -4o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: In capsula imperialium.
Siegel: eine Befestigungsstelle für das angekündigte Siegel von Kaiser Friedrich II (SD1).
Abschriften
B. spätes 13. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskaittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 3v-4v (= neues fol. 20v-21v), Nr. 6, nach A. - C. 1640, Ibidem, idem, Inv. Nr. 1741 (cartularium) = Liber sive regestum originis ecclesie Sancti Seruatii Traiec[tensis] illiusque privilegiorum, donationum ac iurium ex originalibus et libro chartarum manu Ioannis Choris, receptoris capituli, descriptorum, S. 71-72, unter der Überschrift: Confirmatio et licentia Frederici secundi faciendi divisionem inter bona prepositi et capituli, nach A. - D. 17. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 12 (cartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (also) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 33v-34v, unter caput: Imperialia, und unter der Überschrift: Approbatio concordie seu divisionis dominiorum facte inter prepositum et capitulum; (von anderer Hand) presentem et aliam confirmationem fol. 45v, zu A. - E. 17. Jahrhundert, Ibidem, idem, inv. no. 13 (cartularium) = [Liber privilegiorum et bonorum], fol. 96r-96v, unter der Überschrift: Confirmatio imperialis super divisione bonorum prepositure, anno 1232 etc., vgl. fol. 93v, möglicherweise zu A. - [F]. 17. Jh., nicht vorhanden, aber bekannt aus c, Abschrift auf Papier, nach C. - G. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftencollectie (ehem.) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jh., Inv. Nr. 199a (Kartular) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, S. 308, unter der Überschrift: Confirmatio et licentia Frederici secundi facienda divisionem inter bona prepositi et capituli, anno 1232 secunda aprilis, beglaubigte Kopie von G.J. Lenarts, Stadtschreiber von Maastricht, an B. - [H]. 1784, nicht vorhanden, aber bekannt aus c, Abschrift von J.H. Cruts, Scholaster des Sint-Servaaskapitels in Maastricht, nach D.
Ausgaben
a. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica IV-1, 322-323, nach einer Abschrift in einem Kartular des Sint-Servaaskapitels in Maastricht (in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin). - b. Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkundenbuch, 109-110, Nr. 157, nach A. - c. Willemsen, 'Inventaire', 167-170, Nr. 7 (datiert April 1232) , nach [F] und [H]. - d. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit, 317, Nr. 99b (unvollständig), nach a. - e. DiBe ID 19235, nach a. - f. Friedl et al., Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 96-99, Nr. 1495, nach A.
Zusammenfassungen
Siehe Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 96.
Ursprung und Kohärenz
Nach Zinsmaier, "Die Reichskanzlei", 149, ist die vorliegende Urkunde eine von achtzehn Urkunden, die in einem kurzen Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren von einem der fünf Beamten, die abwechselnd in der Reichskanzlei tätig waren, angefertigt wurden. Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 97, identifizieren den Schreiber als notarius Johannes de Capua. Problematisch ist die Zuschreibung des Diktats. Die fehlende Tagesangabe in der datatio ist ein häufiges Phänomen in den Urkunden Friedrichs II., siehe Ficker, Beiträge, 364-365. Die Urkunde von 1232 von Otto, Propst des Aachener Liebfrauenkapitels und des Sint-Servaaskapitels in Maastricht, in der die Bänke zwischen der Propstei und dem dem Sint-Servaaskapittel aufgeteilt werden, befindet sich in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no 9309. Siehe ferner Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit (Der mittelalterliche Grundbesit, 41, 82-85 und 316, Nr. 99a (unvollständige Ausgabe).
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht ohne weiteres ersichtlich.

Nummer 16
Hendrik, Verwalter des Klosters Sint-Gerlach in Houthem, gibt die Entscheidung bekannt, die er auf die Bitte des Klosters, der Nonne Anna von Sint-Gerlach und einiger ihrer Freunde getroffen hat. Bei der Gedenkfeier zum Todestag des Ritters Gozewijn Dukere werden fünf Lütticher Schilling gezahlt für eine Bewirtung des Klosters zu Lasten der Güter in Weestenrode . Gozewijn hatte diese Güter Anna zu ihrem Unterhalt zugewiesen. Nach Annas Tod gehen diese Güter in den Besitz des Klosters über.
Hendrik, Probst des Klosters Sint-Gerlach (in Houthem), bestimmt auf Bitten des Klosters, von Anna, Nonne von Sint-Gerlach, und einiger ihrer Freunde, daß am jährlichen Todestag des Ritters Gozewijn Dukere fünf Lütticher Schillinge für eine Pitanz des Klosters ausgezahlt werden aus den Gütern in Weestenrode , die Gozewijn Anna zu ihrem Unterhalt abgetreten hatte und die nach ihrem Tod dem Kloster zufallen werden .
Original
[A]. Nicht vorhanden, dargestellt durch B, versiegelt mit zwei Siegeln.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 363, unter der Überschrift: Litera de bonis in Westenroede iacentibus, und am Rande: Num. 220, unter Angabe von zwei Siegelstellen, zu [A].
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.


Nummer 16
Hendrik III., Bischof von Lüttich, genehmigt die Übertragung der Patronatsrechte an den Kirchen von Gilze, Baarle und Geertruidenberg durch Hildegonde, Äbtissin von Thorn, an Kanoniker und Nonnen der Abtei Thorn. Er bestätigt auch die in ihrer Schenkungsurkunde enthaltenen Bestimmungen über den Wohnsitz und die Einkünfte des zu bestellenden Pfarrers.
Heinrich III., Bischof von Lüttich, genehmigt die Übertragung des Patronats über die Kirchen von Gilze, Baarle und Geertruidenberg durch Hildegonde, Äbtissin von Thorn, an die Kanoniker und Ordensschwestern von Thorn mit den darin festgelegten Bedingungen.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, prel. inv. Nr. 2220.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 341-343, Nr. 1040, nach A.
Kohärenz
Für die Schenkung dieses Patronatsrechts durch Hildegonde, Äbtissin von Thorn, siehe Sammlung Thorn, Nr. 15.


Nummer 16
Filips I., Erzbischof von Köln, fordert seinen Neffen Goswijn auf, die Schenkung der Kirche von Spaubeek durch Adelheid, Ehefrau von Reinier van Beek, mit dem gesamten Zehnten und zwei großen Höfen (mit zwei "bunder" Land) an die Abtei Kloosterrade, über die es einen Streit gegeben hatte, als gültig zu betrachten und unter Vormundschaft zu stellen.
Filips I., Erzbischof von Köln, fordert seinen Neffen Goswijn auf, die Schenkung der Kirche von Spaubeek durch Adelheid, Ehefrau von Reinier van Beek, mit dem gesamten Zehnten und zwei großen Höfen (mit zwei "bunder" Land) an die Abtei Kloosterrade, über die es einen Streit gegeben hatte, als gültig zu betrachten und unter Vormundschaft zu stellen.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 818.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 95-97, Nr. 41, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 16
Kaiser Friedrich II. erneuert und bestätigt auf Ersuchen von Jan, Kanoniker des Maastrichter Sint-Servaaskapitels, die von Kaiser Heinrich IV. im Jahr 1087 dem Maastrichter Sint-Servaaskapitel verliehene Urkunde.
Kaiser Friedrich II. erneuert und bestätigt auf Ersuchen von Jan, Kanoniker des Maastrichter Sint-Servaaskapitels, die von Kaiser Heinrich IV. im Jahr 1087 dem Maastrichter Sint-Servaaskapitel verliehene Urkunde.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 39. Gefüttert.
Notiz auf der Rückseite: 1o von einer Hand des 14. Jahrhunderts: Confirmatio Frederici de datoMo CCo XXXIIo. - 2o von einer Hand des 14. Jahrhunderts: De exemptione serviciarum faciendum dominis episcopalibus, confirmato per (teilweise unter aufgeklebtem Stück Papier) Fredericum et inseritur exemptio prius facte per (teilweise unter aufgeklebtem Stück Papier) Henricum, imperatorem, que est de data anno Domini M LXXXVII / b / E XIIII. - 3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 1232. - 4ovon einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: Capsula imperialium. - 5ovon einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: Exemptio I. und 4(durchgestrichen).
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Kaiser Friedrich II, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Zegels, Nr. 45.
Abschriften
B. 1273 Oktober 15, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 40, Vidimus von Meister Baudouin von Autre-Église, Kanoniker des Domkapitels in Lüttich und Beamter von Lüttich, nach A. - C. 1282 April 9, Ibidem, idem, Inv. Nr. 42, Insertion in eine Urkunde des römischen Königs Rudolf I., nach A. - D. Ende 13. Jahrhundert, Ibidem, idem, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 10 (cartularium) = [Liber privilegiorum], fol. 1r-1v (= neue fol. 18r-18v), Nr. 1, nach A. - E. 17. Jahrhundert, Ibidem, idem, Inv. Nr. 12 (cartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (also) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 34v-36v, unter caput: Imperialia, und unter heading: Capitulum Sancti Servatii soli pontifici et imperatoribus subest, dignitas cleri, sedes 20 episcoporum, nach A. - [F]. nicht vorhanden, aber bekannt aus G, cartularium Sint-Servaaskapiitel in Maastricht = Liber A, fol. 198. - G. vor 1768, Ibidem, Zugang Nr. 22.001A, Handschriftensammlung (ehemals) Stadtarchiv Maastricht, 14.-20. Jahrhundert, Inv. Nr. 199a (Kartularium) = Diplomata Trajectensia de anno 800 ad 1664, S. 8, unter der Überschrift: Fredericus 2, imperator, confirmat privilegium Henrici quarti, Romanorum regis, capitulo Sancti Servatii, datum X indictio 1087, de eorum exemptione, in decembris, 7 indictione, möglicherweise an [F]. - H. vor 1768, Ibidem, idem, S. 373, unter der Überschrift: Fredericus, imperator, confirmat privilegium Henrici quarti, imperatoris, quo remittit ecclesie Sancti Servatii omne ius beneficialis servitii, anno 1252 6ta (später durchgestrichen und auf Dezember 1232 geändert) decembris, möglicherweise an D. - [I]. 1784, nicht verfügbar, aber bekannt aus Willemsen, 'Inventaire', 167-170, Nr. 7, Kopie von J.H. Cruts, Scholastiker des Sint-Servaaskapitels in Maastricht, nach E.
Ausgaben
a. Hackeng, Het middeleeuwse grondbezit 312, Nr. 96e (unvollständig), nach A. - b. DiBe ID 19371, nach einer Ausgabe des 18. Jahrhunderts. - c. Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 223-227, Nr. 1543, nach A, siehe dort weiter.
Zusammenfassungen
Siehe Friedl et al, Die Urkunden Friedrichs II. 1232-1236, 224.
Ursprung und Kohärenz
Nach Zinsmaier, "Die Reichskanzlei", 149, ist die vorliegende Urkunde die letzte in einer Reihe von achtzehn Urkunden, die in einem kurzen Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren von einem der fünf Beamten, die abwechselnd in der Reichskanzlei tätig waren, angefertigt wurden.
Friedl et al., o.c., 224, identifizieren den Schreiber als notarius Johannes de Capua; das Chrismon und der Name des Kaisers könnten von Johannes de Lauro oder Albertus de Catania geschrieben worden sein. Die fehlende Tagesangabe in der datatio ist ein häufiges Phänomen in den Urkunden Friedrichs II., siehe Ficker, Beiträge, 364-365. Für die inschriftliche Urkunde Heinrichs IV. von 1087 siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 2. Für eine Bestätigung und Erneuerung der vorliegenden Urkunde durch den römischen König Rudolf I. vom 9. April 1282, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 49. Im September 1233 wurden auf Antrag der Kanoniker des Sint-Servaaskapitels in Maastricht zwei Urkunden ausgestellt, die die vorliegende Urkunde bestätigten: eine vom Dekan und Kapitel Unserer Lieben Frau in Aachen und eine von Kantor und Kanonikern des Sankt-Adelbertkapitels in Aachen. Beide Urkunden sind als Kopie in einem Kartular vpn Sint-Servaas erhalten (in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no 10180, fol. 243v). Für den Vidimus von Meister Boudewijn von Autre-Église, Kanoniker des Lütticher Domkapitels und Offizial von Lüttich, datiert 15. Oktober 1273, siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 35.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht ohne weiteres ersichtlich.


Nummer 17
Walram von Monschau, Herr von Valkenburg, gibt bekannt, dass er Jan Ruffus, Bürger von Aachen und Schwiegersohn des Herrn Godfrey van Klimmen, zusammen mit seinen Miterben und mit Jans eigenen künftigen Erben von allen ihm und seinen Erben verpflichteten Abgaben auf den Hof Cardenbeek befreit hat. Dies unter der Bedingung, dass Jan Ruffus und seine Miterben sowie deren Erben jedes Jahr am 2. Februar 1 Pfund Wachs an Walram und seine Erben liefern werden.
Walram von Monschau, Herr van Valkenburg, befreit Jan Ruffus, Bürger von Aachen, Schwiegersohn des Herrn Godfrey van Klimmen, seine Erben und die Teilhaber an Godfreys Gütern von allen Abgaben an dem Hof in Cardenbeek, unter der Bedingung, daß Jan ihm jährlich ein Pfund Wachs liefert.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 57, Reg. Nr. 13.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Littera de curte in Cardenbeck quod sit libera ab exactione.- 2°von der Hand des letzten Viertels des 14. Jahrhunderts: J j. - 3°von der Hand des17. Jahrhunderts: Vrijdom van Cartebeeck, 46.- 4°von der Handdes 18. Jahrhunderts: Num. 93.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Walram van Monschau, Herr van Valkenburg, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 158-159.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 1 (Kartular), S. 140-141, unter der Überschrift: Litere domini Walrami de curte in Cartenbecke, quod sit libera ab omni exactione, und am Rande: Num. 93, unter Angabe einer Siegelstelle, an A.
Ausgabe
a. Franquinet, Aufgezeichnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 17, Nr. 12, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 72, Reg.-Nr. 13. - Idem, Chronologische Liste, 62, Reg.-Nr. 149.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 17
Hildegonde, Äbtissin von Thorn, ratifiziert das Dekret von Hendrik III. Der Bischof beschloß dies nach einer Visitation durch Meister Reinier, Scholaster in Tongeren und sein Provisor in geistlichen Angelegenheiten, der feststellte, daß die Kanoniker und Nonnen von Thorn nicht ausreichend von ihren Präbenden (Pfründen) leben und ihren Verpflichtungen nachkommen konnten. Der zu ernennende Kleriker muß die Priesterweihe empfangen oder schon bekommen haben, freiwillig auf ein anderes Benefizium (Einkommen) verzichten und innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung in Baarle wohnen. Er wird mit einem angemessenen Benefizium ausgestattet; die übrigen Früchte der Kirche von Baarle werden von den Chorherren und Nonnen von Thorn zur Erhöhung ihrer Präbenden (Pfründe) verwendet.
Hildegonde, Äbtissin von Thorn, ratifiziert die Bestimmung Heinrichs III., Bischof von Lüttich, vom 13. Oktober 1262, über die Einsetzung des Pfarrers von Baarle und die Festlegung seiner Einkünfte.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 28.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 341-343, Nr. 1044, nach A.
Datierung
Die Datierung der vorliegenden Urkunde scheint derjenigen der ratifizierten Urkunde zu widersprechen, die erst am 13. Oktober 1262 ausgestellt wurde (siehe Sammlung Thorn, Nr. 19). Da sich die Äbtissin in der corroboratio ausdrücklich auf diese Urkunde des Bischofs bezieht, die offenbar bereits am 10. Oktober 1262 verfasst wurde, kann der Widerspruch in den Datierungen nicht durch einen Zeitunterschied zwischen der actio und der conscriptio erklärt werden. Wahrscheinlich bezieht sich die Äbtissin auf das für den Bischof in Thorn vorbereitete mundum, das nur drei Tage später in der bischöflichen Kanzlei validiert und datiert wurde.
Ursprung und Kohärenz
Diese Urkunde der Äbtissin und des Konvents der Abtei Thorn aus dem Jahr 1262 wurde von derselben Hand geschrieben wie die Urkunden der Äbtissin von Thorn aus den Jahren 1262 und 1265 sowie andere Urkunden im Namen der Abtei, nämlich von Dirk van Heeswijk aus dem Jahr 1267, von Abt und Konvent der Sint-Paulusabtei in Utrecht 1269 (zwei Originale), vom Pfarrer von Oeteren 1270, von Michael, Kanoniker des Kapitels Unserer Lieben Frau in Maastricht, und Godfrey Bec van Übach 1272, von einer Reihe von Rittern 1272 und von Äbtissin, Konvent und dem Herrn van Horn 1273, siehe Sammlung Thorn, Nr. 18, 23, 26, 28, 34, 37, 38 und 39. Folglich kann dieser Skriptor in der Abtei Thorn lokalisiert werden.
Weitere Bestimmungen über die Einkünfte der Kirche von Baarle finden sich in der Urkunde von Engelbert van Isenburg, Archidiakon von Lüttich, vom 15. Mai 1270 (Sammlung Thorn, Nr. 35).


Nummer 17
Philipp I., Erzbischof von Köln, bestätigt dem Kloster Marienthal den Besitz der genannten Güter, darunter den von der Abtei Kloosterrade geschenkten Hof Nentrode, vorbehaltlich von neun Waldanteilen, die zu Ahrweiler gehörten; drei dieser Anteile sind später an Marienthal übertragen worden.
PhilippI., Erzbischof von Köln, bestätigte dem Kloster Marienthal den Besitz der genannten Güter, darunter den von der Abtei Kloosterrade geschenkten Hof Nentrode, vorbehaltlich von neun Waldanteilen, die zu Ahrweiler gehören; drei dieser Anteile sind später an Marienthal übertragen worden.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 1649 (ehemals Rolduc, Urkunden, Nr. 8). Einige Textverluste durch Abnutzung, besonders oben rechts.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 97-101, Nr. 42, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.
Textausgabe
Aufgrund der Abnutzung sind einige Buchstaben unleserlich geworden. Für den Nachtrag siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 17
Der römische König Heinrich VII. befiehlt dem Schulzen von Aachen, die Schulzen und Bürger der Diözese Lüttich zu zwingen, dem Bischof nicht mehr zu gehorchen, nachdem er den Bischof von Lüttich mehrfach aufgefordert hatte, das Sint-Servaaskapitel in Maastricht nicht mehr zu belästigen und dem Kapitel die Unkosten von hundert Mark zu erstatten.
Der römische König Heinrich VII. befiehlt dem Schulzen von Aachen, die Schulzen und Bürger der Diözese Lüttich zu zwingen, dem Bischof nicht mehr zu gehorchen, nachdem er den Bischof von Lüttich mehrfach aufgefordert hatte, das Sint-Servaaskapitel in Maastricht nicht mehr zu belästigen und dem Kapitel die Unkosten von hundert Mark zu erstatten.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 53.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Mandatum regis / M VIII. - 2o von einer Hand des 14. Jahrhunderts: [Litte]ra quod episcopus Leodiensis aliquid agatur contra nos. - 3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Q 2. -4o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: 39. -5o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: M VIII 3. - 6o von einer Hand aus dem 17. - 7o von einer Hand aus dem 18. Jahrhundert: 44 durchgestrichen.
Das Siegel wurde nicht angekündigt, und es gibt auch keine Spuren eines Siegels, im Gegensatz zu Zinsmaiers Erwähnung eines abhängenden Siegels.
Kopie
B. 17. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas inMaastricht, 1062-1797, Inv. Nr. 12 (Kartularium) = Cartularium ecclesie collegialis Sancti Servati (also) Trajecti ad Mosam, tomus secundus, Documenta imperialia et ducalia, fol. 15r-v, mit caput: Mandatum Henrici, imperatoris, ad scholtetum Aquensem ut compellat scholtetos et cives diocesis Leodiensis non solvere episcopo Leodiensi donec usw., möglicherweise an A.
Ausgaben
a. Zinsmaier, "Acht ongedrukte Königsurkunden", 64, Nr. 7, zu A. - b. DiBe ID 28119, zu a.
Zusammenfassungen
Doppler, "Verzameling", 284-285, Nr. 125. - Böhmer und Zinsmaier, Regesta imperii V-4, 83, Nr. 571. - Haas, Chronologischee Lijst, 42-43, Nr. 82. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 53, Nr. 53.
Datierung
Die vorliegende Urkunde fällt in das siebte Jahr der Indiktion während der Herrschaft des römischen Königs Heinrich VII. und kann auf das Jahr 1234 datiert werden. Dies wird durch die am selben Tag ausgestellte königliche Urkunde bestätigt, siehe unter Herkunft und Zusammenhang
Ursprung und Kohärenz
Nach Zinsmaier, "Acht ungedruckte Königsurkunden", 643, wurde die vorliegende Urkunde in der königlichen Kanzlei redigiert und geschrieben. Für eine Ausgabe der Charta, die in der Dispositio des römischen Königs Heinrich VII. vom 20. September 1234 an den Schulzen und die Bürger von Lüttich, Maastricht, Sint-Truiden, Hoei, Tongeren und Dinant erwähnt wird, siehe DiBe ID 19834.


Nummer 18
Walram, Herr von Valkenburg und Monschau, überlässt dem Kloster Sint-Gerlach in Houthem für ewig und immer den Besitz des Durchgangsweges durch das Dorf. Dies zum Wohle seiner eigenen Seele und um die Armut der Nonnen zu bekämpfen. Dieser Weg muss für alle Gläubigen frei zugänglich bleiben, damit sie den Schwestern Almosen geben können.
Walram, Herr van Valkenburg und Monschau, schenkt dem Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) die Straße durch das Dorf Sint-Gerlach.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 41, Reg. Nr. 14.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1° von einer Hand ausdem 13. Jahrhundert: Dominus Walramus contulit stratam publicam nostre ecclesie in vera elemosina. - 2°von der Hand aus dem letzten Vierteldes 14. Jahrhunderts: E j. - 3o von der Hand des 17. Jahrhunderts: 1270. - 4o von der Hand des 18. Jahrhunderts: Num. 72.
Siegel: ein doppelt durchstochenes, hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 vonWalram, Herr van Valkenburg und Monschau, aus grünem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 158-159.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 118-119, unter der Überschrift: Litere domini Walrami de Valckenburgh de platea, und am Rande: Num. 72, unter Angabe einer Siegelstelle, zu A.
Ausgabe
a. Franquinet, aufgezeichnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 17-18, Nr. 13. nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 72, Reg.-Nr. 14. - Idem, Chronologische Liste, 63, Reg.-Nr. 153.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.
Übersetzung
Laut Franquinet, Aufgezeichnetes Inventar Sint-Gerlach, IV, 19-20, Nr. 14, wurde eine Simultanübersetzung der vorliegenden Urkunde ins Mittelniederländische angefertigt. Diese Pergamentübersetzung wird derzeit noch zusammen mit dem Original aufbewahrt. Paläographische Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß es sich bei der Übersetzung nicht um eine Schrift aus dem dreizehnten Jahrhundert handelt, sondern um eine spätere Ausgabe. Diese Übersetzung wurde nicht in das Kartular aus dem 18. Jahrhundert kopiert und trägt in Dorso (auf de Rückseite) die Nummer 79, die dem lateinischen Text der vorliegenden Urkunde entspricht.


Nummer 18
Hildegonde, Äbtissin von Thorn, kündigt an, daß Meister Reinier, Scholaster in Tongeren und Provisor in geistlichen Angelegenheiten von Hendrik III, Bischof von Lüttich, das Kloster besucht hat. Er stellte fest, daß der Zehnte von Gilze, den sich die Adligen von Breda viele Jahre lang unrechtmäßig angeeignet hatten, freiwillig an die Abtei zurückgegeben worden ist. Der Bischof erklärte den Zehnten als Recht und Eigentum der Abtei und legte fest, daß die Präbenden von Kanonikern und Nonnen auf ewig gleich sein werden und daß die Äbtissin mit deren Zustimmung einen Pfarrer in der Kirche von Gilze und Kapläne in den Nebenkirchen einsetzen wird. Der Bischof von Lüttich wird diesem Pfarrer auch eine entsprechende Pfründe erteilen. Diese Anordnung des Bischofs von Lüttich wird von der Äbtissin von Thorn ratifiziert.
Hildegonde, Äbtissin von Thorn, ratifiziert die Vereinbarung Heinrichs III., Bischof von Lüttich, vom 13. Oktober 1262, über die Rückgabe des Zehnten von Gilze, die Einsetzung des dortigen Pfarrers und die Festlegung seiner Einkünfte.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, prel. inv. Nr. 2221.
Ausgabe
a. Dillo und Van Synghel, ONB II, 355-357, Nr. 1045, nach A.
Datierung
Die Datierung der vorliegenden Urkunde scheint im Widerspruch zu derjenigen der - verlorenen ̶ - ratifizierten Urkunde zu stehen, die erst am 13. Oktober 1262 ausgestellt wurde (siehe Sammlung Thorn, Nr. 19). Da sich die Äbtissin in der corroboratio ausdrücklich auf diese Urkunde des Bischofs bezieht, die offenbar bereits am 10. Oktober 1262 verfasst wurde, kann der Widerspruch in den Daten nicht durch einen Zeitunterschied zwischen der actio und der conscriptio erklärt werden. Wahrscheinlich bezieht sich die Äbtissin auf das für den Bischof in Thorn vorbereitete mundum, das nur drei Tage später in der bischöflichen Kanzlei validiert und datiert wurde.
Herkunft
Diese Urkunde wurde von einem Skriptor der Abtei Thorn mundiert, der von 1262 bis 1273 tätig war. Zum Auffinden dieses Schreibers siehe Sammlung Thorn, Nr. 17.

Nummer 18
Philipp I., Erzbischof von Köln, beurkundet, dass Kunisa van Reifferscheid zusammen mit ihrem Vater, dessen Erben und ihrem Ehemann einerseits und Herzog Godfried III. van Leuven als Lehnsherr zusammen mit seinen Söhnen Hendrik, Adelbert und mit Hendrik III. van Limburg andererseits den Teil der Zehnten von Lommersum, den Kunisa von Godfrey zu Lehen hatte, an die Abtei Kloosterrade übertragen.
Philipp I., Erzbischof von Köln, beurkundet, dass Kunisa van Reifferscheid zusammen mit ihrem Vater, dessen Erben und ihrem Ehemann einerseits und Herzog Godfried III. van Leuven als Lehnsherr zusammen mit seinen Söhnen Hendrik, Adelbert und mit Hendrik III. van Limburg andererseits den Teil der Zehnten von Lommersum, den Kunisa von Godfrey zu Lehen hatte, an die Abtei Kloosterrade übertragen.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv. Nr. 803, 2. Durch Riss stark beschädigt, rückseitig mit einem Pergamentstreifen repariert.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 101-102, Nr. 43, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 18
Das Onze-Lieve-Vrouwkapitel in Maastricht erklärt, dass es die Urkunde von Kaiser Heinrichs IV. aus dem Jahr 1087 gesehen hat, die weder durchgestrichen noch ausradiert ist, und gibt ihren Text wieder.
Das Onze-Lieve-Vrouwkapitel in Maastricht vidimiert die Charta von Kaiser Heinrich IV. aus dem Jahr 1087.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 37.
Anmerkungen zur Rückseite: 1o von Händendes 14. und 16. Jahrhunderts: Transumptum privilegii Henrici imperatoris de exemptione ecclesie et prepositure sub sigillo capituli BeateMarie Traiectensis, datumMo LXXXVIIo. - 2ovon einer Hand des 16. Jahrhunderts: v / 2 4. - 3ovon einer Hand des 16. Jahrhunderts: Anno 1087. - 4o von einer Hand des 16. Jahrhunderts: f II. - 5o von einer Hand des 17. Jahrhunderts: In capsula imperialium. - 6ovon einerHand des 18. Jh.: R. MJ nu. 25.
Siegel: eine Befestigungsstelle, vermutlich für das angekündigte Siegel des Onze-Lieve-Vrouwkapitels in Maastricht (SD1).
Kopie
B. 15. Jahrhundert, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B001, archief kapittel van Onze Lieve Vrouw in Maastricht, 1096-1796, Inv.-Nr. 31 (Kartular), fol. 176r-177r, unter der Überschrift: Item tenores omnium et singulorum exhiborum sequuntur per ordinem in hunc modum et sunt tales, möglicherweise nach A.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Zusammenfassungen
Haas, Chronologische lijst, 106, Nr. 295 (aus dem 13. Jahrhundert). - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 51, Nr. 37 (aus dem 13. Jahrhundert).
Kohärenz
Für die vidiemierte Charta von Kaiser Heinrich IV. siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 2.
Datierung
Die vorliegende Urkunde ist nicht datiert. Haas und Nuyens datieren sie in das 13. Jahrhundert. Paläographische Untersuchungen zeigen, dass die Schriftart mit der einer Urkunde von Arnoud, Propst des Sankt-Gereonkapitels in Köln, einer Urkunde des Onze-Lieve-Vrouwkapitels in Maastricht, datiert auf 1232 Mai und 1233 September, verwandt ist (siehe Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B001,archief kapittel Onze-Lieve-Vrouw in Maastricht, 1096-1796, Inv. 909 und 910), und eine Urkunde des Dekans und des Sint-Lambertuskapitels in Lüttich vom Mai 1244 (siehe Ibidem, Zugang Nr. 14.D033, Archiv proosdij Meerssen, 968-1746, Inv. 1024). Daher datieren wir diese Urkunde in das zweite Viertel des dreizehnten Jahrhunderts. Nicht unwahrscheinlich ist eine Datierung um 1232-1233, als das Sint-Servaaskapitelapitel in Maastricht im Dezember 1232 die Urkunde Kaiser Heinrichs IV. von 1087 erneuern und von Kaiser Friedrich II. bestätigen ließ (siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 16) und bittet um eine Beglaubigung durch den Dekan und das Kapitel Unserer-Lieben-Frau in Aachen sowie durch den Kantor und die Kanoniker von Sankt-Adelbert in Aachen im September 1233 (aufbewahrt in Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Latin, Manuscrits no. 10180, fol. 243v).


Nummer 19
Walram, Herr von Valkenburg und Monschau, bezeugt, daß Ritter Gerard van der Huven in seiner Gegenwart den Verkauf eines Teils des Zehnten von Spaubeek bestätigt hat. Er tat dies für 21 Lütticher Pfund an den Verwalter, die Magistra und den Konvent des Klosters Sint-Gerlach in Houthem. Es handelte sich dabei um zwei Mud Roggen (Maastricht-Maß), die auf ewig jährlich am Sint-Andreastag (30. November) zu zahlen sind. Dieser Verkauf fand mit Zustimmung seines verstorbenen Vaters Dirk II. statt, dem Herrn van Valkenburg. Zum Zeitpunkt des Verkaufs besaß Ritter Gerard diesen Zehnten als Lehen von Dirk II. Zum Zeitpunkt des Zeugnisses von Herrn Walram befand sich dieser Zehnte in seinem Besitz als Lehnsherr. Auch er ist mit dem Verkauf einverstanden.
1271 (3. April - 1272 21. April)
Walram, Herr van Valkenburg und Monschau, genehmigt den von Gerard van der Huven, Ritter, in Anwesenheit und mit Zustimmung seines Vaters (Dirk II.), Herr van Valkenburg, getätigten Verkauf von zwei mud Roggen aus dem Zehnten von Spaubeek für 21 Lütticher Pfund an den Probst, die Magistra und den Konvent des Klosters Sint-Gerlach (in Houthem).
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 87, Reg. Nr. 15.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 13. Jahrhundert: Littera de II modiis siliginis in Spauberch. - 2° von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: 1271. - 3° von der Hand des 18. Jahrhunderts: Num. 83.
Siegel: ein hängend befestigtes, doppelt durchstochenes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Walram, Herr van Valkenburg und Monschau, aus braunem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 158-159.
Kopie
B. 1735, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 1 (Kartular) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 129-130, unter der Überschrift: Reditus duorum modiorum siliginis ex decimis in Spaubeek, und am Rande: Num. 83, unter Angabe einer Siegelstelle, zu A.
Ausgabe
a. Franquinet, aufgezeichnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 20-21 (datiert 1271), nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 73, Reg. Nr. 15 (datiert 1271). - Idem,Chronologische Liste, 65, Reg. Nr. 160 (datiert 1271).
Datierung
Die Verwendung des Osterstils in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.

Nummer 19
Hendrik III., Bischof von Lüttich, teilt mit, daß Reinier, Scholaster in Tongeren und sein Provisor in geistlichen Angelegenheiten, auf seine Bitte hin und mit besonderen Anweisungen die Abtei Thorn erneut besucht hat. Da Reinier festgestellt hat, daß die Präbenden (Pfründe) der Kanoniker und Nonnen zu klein sind, um davon leben zu können, beschließt der Bischof, daß die Äbtissin, die das Patronatsrecht über die Kirche von Baarle innehat, dort mit Zustimmung der Kanoniker und Nonnen einen Pfarrer einsetzen wird. Der zu ernennende Geistliche muß die Priesterweihe empfangen oder empfangen haben, freiwillig auf ein anderes Benifizium (Pfründe) verzichten und innerhalb eines Jahres nach der Ernennung in Baarle wohnen. Ihm wird eine angemessene Pfründe zugewiesen. Der Rest der Früchte der Kirche von Baarle wird von den Kanonikern und Klosterschwestern von Thorn zur Erhöhung ihrer Pfründen verwendet, die gleich hoch und für immer gleich sein werden.
Heinrich III., Bischof von Lüttich, bestimmt nach der Visitation der Abtei von Thorn durch Reinier, Scholaster in Tongeren und sein Provisor in geistlichen Angelegenheiten, daß die Äbtissin von Thorn, die das Patronatsrecht über die Kirche von Baarle innehat, mit Zustimmung der Kanoniker und Nonnen von Thorn einen Pfarrer einsetzt, und er bestimmt auch dessen Einkommen.
Original
[A]. Nicht verfügbar.
Abschrift
B. erste Hälfte des 15. Jahrhunderts, Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv. Nr. 1628 (ehemals Cartularium Nr. 1) = Cartularium abbatiae imperialis Thorensis, 966-1600, S. 161-162 (altes fol. 85r -85v), unter der Rubrik: De ecclesia de Baerle incorporatio), beglaubigte Kopie von S. van Neeroeteren, an [A].
Ausgabe
a. Dillo-Van Synghel, ONB II, 357-359, bis 1046, nach B.
Datierung
Die Datierung der vorliegenden Urkunde scheint im Widerspruch zu derjenigen der Urkunde der Äbtissin von Thorn zu stehen, die drei Tage zuvor die Bestimmungen des Bischofs von Lüttich über Baarle ratifiziert (siehe Sammlung Thorn, Nr. 17). Da sich die Äbtissin in der corroboratio ausdrücklich auf die bischöfliche Urkunde über Baarle bezieht, die offenbar bereits am 10. Oktober 1262 verfasst wurde, lässt sich der Widerspruch in den Daten nicht durch einen Zeitunterschied zwischen der actio und der conscriptio erklären. Die Äbtissin bezieht sich wahrscheinlich auf das in Thorn für den Bischof vorbereitete mundum, das nur drei Tage später in der bischöflichen Kanzlei validiert und datiert wurde.
Kohärenz
Weitere Bestimmungen über die Einkünfte der Kirche von Baarle finden sich in der Urkunde von Engelbert van Isenburg, Archidiakon von Lüttich, vom 15. Mai 1270 (siehe Sammlung Thorn, Nr. 35).


Nummer 19
Vereinbarung zwischen Godschalk van Aubel und seiner Frau einerseits und Abt Erpo und dem gesamten Konvent von Kloosterrade andererseits, wonach die ersteren der Abtei mehr als 43 Mark Silber für den Erwerb bestimmter Güter schenken, unter der Bedingung, dass sie den Nießbrauch davon genießen werden.
Vertrag zwischen Godschalk van Aubelund seiner Frau einerseits und Abt Erpo und dem gesamten Konvent von Kloosterrade andererseits, wonach die ersteren der Abtei mehr als 43 Mark Silber für den Erwerb bestimmter Güter schenken, unter der Bedingung, dass sie den Nießbrauch davon genießen werden.
Originale
A1. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 860. Chirograph, da der Fundort für die Abtei bestimmt ist.
[A2]. Nicht verfügbar, scheint aber eine für die Gegenpartei bestimmte Querschnittschirographie zu sein.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade , 108-110, Nr. 48, zu A1.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 19
Der römische König Willem (Graaf van Holland) befiehlt den Vögten, Schulzen, Schöffen und Bürgern von Maastricht, die Rechte und Privilegien des Sint-Servaaskapitels in Maastricht und der dortigen Beschäftigten zu achten.
Der römische König Willem (Graaf van Holland) befiehlt den Vögten, Schulzen, Schöffen und Bürgern von Maastricht, die Rechte und Privilegien des Sint-Servaaskapitels in Maastricht und der dortigen Beschäftigten zu achten.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 20.
Siegel: ein hängend befestigyes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 des römischen Königs Willem, Graaf van Holland, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung des Siegels, siehe Venner, "Zegels", Nr. 47.
Abschriften
Siehe Hägermann und Kruisheer, Die Urkunden Heinrich Raspes und Willem van Holland, 263-264, Nr. 211.
Ausgabe
a. Hägermann und Kruisheer, Die Urkunden von Heinrich Raspe und Willem van Holland, 263-264, Nr. 211, nach A.
Zusammenfassungen
Siehe Hägermann und Kruisheer, Die Urkunden Heinrich Raspes und Willem van Holland, 263-264, Nr. 211.
Datierung
Die vorliegende Urkunde fällt in das zehnte Indiktionsjahr der Herrschaft des römischen Königs Wilhelm. Daher kann diese Urkunde auf das Jahr 1252 datiert werden.
Herkunft
Nach Hägermann, Studien, 264, wurde die vorliegende Charta vom Kanzleischreiebr WA redigiert und verfasst.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.

Nummer 20
Margareta, Nonne des Klosters Sint-Gerlach in Houthem, Tochter von Wolter und Oda van Stercbeeke, hat sechs "Bunder" Land (etwa 4,8 ha) in Dirgarden zugunsten einer jährlichen Weinspende an das Kloster gekauft; außerdem hat sie zwölf Lütticher Schilling in Heek zugunsten einer Spende an das Kloster an den Festtagen der Heiligen Katharina, des Heiligen Johannes des Evangelisten und des Heiligen Nikolaus gekauft. Außerdem kaufte sie in Haasdal 35 kg Roggen, zu zahlen an den Konvent für den Gedenkgottesdienst am Todestag von Mathilde, der ehemaligen Dame von Berg. Auf dem Bauernhof von Raar kaufte sie drei Morgen Land , um am Todestag ihres Vaters Wolter und ihrer Mutter Oda van Stercbeeke ewige Gedenkfeiern abzuhalten. Für die Lampe von Sint Gerlach in der Kirche von Sint-Gerlach kaufte sie einen halben "bunder" Land (0,4 ha), auf dem örtlichem Feld, und im Hof von Raar 35 kg Roggen, jährlich zu zahlen für die Lampe über dem Chor des Klosters von Sint-Gerlach.
Es wird verkündet, daß Margareta, Nonne des Klosters Sint-Gerlach (in Houthem), Tochter von Wolter und Oda vanStercbeeke, sechs Morgen Land in Dirgarden zu Gunsten der Weinspende an das Kloster gekauft hat, sowie zwölf Lütticher Schillinge in Heek zu Gunsten einer Spende an das Kloster an den Festtagen der Heiligen Katharina, Johannes Evangelist und Nikolaus, eine bestimmte Menge Roggen in Haasdal für den Jahrzeitmesse von Mathilde, ehemals Frau van Berg, der an das Kloster zu zahlen ist, im Hof in Raar drei Morgen Land für die Jahrzeitemessen ihrer Eltern, einen halben Hektar Land für die Lampe des Heiligen Gerlach in der Kirche und eine bestimmte Menge Roggen für die Lampe über dem Chor des Klosters.
Original
[A]. Nicht vorhanden, nach B mit einer Plombe gesiegelt.
Kopie
B. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 122-123, unter der Überschrift: Litere Margarete, monialis sancti Gerlaci, de 6 bonnariis apud Dirgarde, in Heeke 12 flor. Leodienses usw., und am Rande: Num. 76, unter Angabe einer Siegelstelle, zu [A].
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.


Nummer 20
Der Konvent der Abtei Thorn gibt bekannt, daß Aleid van Nathen, Aleid und Elisabeth, Nonnen des Klosters, sowie die Laien Christiaan und Dirk und viele andere, die zur familia des Klosters gehören, der Kirche von Thorn jährlich am 11. November eine Kopfsteuer schulden. Beim Tod sowie für die Erlaubnis zur Eheschließung muß ein Betrag für die tote Hand entrichtet werden. Außerdem ist die Kirche ihr einziger Vormund.
Der Konvent der Abtei Thorn erklärt, dasß Aleid van Nathen, Aleid und Elisabeth, Klosterschwestern, Christiaan und Dirk, Laien, und viele andere, die zur familia der Kirche Unserer Lieben Frau von Thorngehören , eine jährliche Kopfsteuer von zwei Lütticher Pfennig an die Kirche von Thorn schulden sowie zwei Pfennig bei ihrem Tod oder ihrer Heirat, und daß sie keinen anderen Vormund als die Kirche von Thorn haben werden.
Originale
A1. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Freies Königreich von Thorn, Inv.-Nr. 33. Linker chirographischer Ausschnitt, mit den unteren Buchstaben der Devise: C[Y]RO[G]RAPH[V]M. Beschädigt mit Verlust des Textes.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1ovon einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Pro licentia nubendi sive contrahendi matrimonium dabit et duos denarios, 1263. - 2ovon einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: R durchgestrichen, Z.
Siegel: eine Befestigungsstelle, vermutlich für das angekündigte Siegel der Abtei Thorn (LS1).
[A2]. nicht verfügbar, aber bekannt von A1, rechter Teil des Chirographs.
Ausgaben
a. Franquinet, Revidiertes Inventar Thorn, 27-28, Nr. 17, zu A1. - b. Habets, Archive Thorn, 26, Nr. 33, zu A1.
Regest
Haas, Chronologisches Verzeichnis, 55, Nr. 126.


Nummer 20
Rutger, Abt von Kloosterrade, schlichtet einen Streit zwischen Gerard von Merz, einem Getreuen der Abtei, und Rutger, einem Bürger von Ahrweiler, indem er von letzterem verlangt, gegen Zahlung von sechzehn Schillingen Keuls auf seine Ansprüche auf Weinberge zu verzichten, die er zuerst an den genannten Gerard verpfändet und später verkauft hatte.
Rutger, Abt von Kloosterrade, schlichtet einen Streit zwischen Gerard von Merz,einem Getreuen der Abtei, und Rutger, Bürger von Ahrweiler, und verlangt von letzterem, auf seine Ansprüche auf Weinberge zu verzichten, die er zuerst an den genannten Gerard verpfändet und später verkauft hatte.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 846.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 114-116, Nr. 52, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 20
Garsilius, Dekan, und das Kapitel Unserer- Lieben-Frau in Aachen genehmigen den Vertrag zwischen Koenraad, Kantor des Kapitels, einerseits und dem Dekan und dem Sint-Servaaskapitel in Maastricht andererseits, in dem Koenraad im Namen des Kapitels Unserer-Lieben-Frau den neunten Teil (der Einnahmen) des Dorfes und Allodium von Dilsen in ewiger Pacht an das Sint-Servaaskapitel überträgt gegen einen jährlichen Cijns von fünfzig Lütticher Schilling
Garsilius, Dekan, und das Kapitel Unserer- Lieben-Frau in Aachen genehmigen den Vertrag zwischen Koenraad, Kantor des Kapitels, einerseits und dem Dekan und dem Sint-Servaaskapitel in Maastricht andererseits, in dem Koenraad im Namen des Kapitels Unserer-Lieben-Frau den neunten Teil (der Einnahmen) des Dorfes und Allodium von Dilsen in ewiger Pacht an das Sint-Servaaskapitel überträgt gegen einen jährlichen Cijns von fünfzig Lütticher Schilling
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 321.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: De censu dando cantori Aquenside silva de Dilsene. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: R. 49. - 3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 1255. -4o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 26 / C XVII.
Siegel: zwei Befestigungsstellen, vermutlich für die angekündigten Siegel des Aachener Liebfrauenkapitels und von Koenraad, Kantor des Kapitels (LS1 und LS2).
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Zusammenfassungen
Doppler, "Verzameling", 306, Nr. 170 - Haas, Chronologisch lijst, 49, Nr. 103. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 87, Nr. 321. - Mummenhoff, Regesten Aachen I, 29, Nr. 65.


Nummer 21
Walram, Herr van Valkenburg und Monschau, hat auf Anraten seiner Räte Ritter Arnoud, Herr van Stein, Ritter Gozewijn van Borgharen, Ritter Jan van Haasdal und van Raas van Printhagen, dreißig "bunder" (24 ha) seines Waldes von Buchoit an Arnoud van Houthem verkauft. Dies in der Absicht, daraus Ackerland zu machen. Diese dreißig "bunder" werden, wie auch die anderen Lehen, die Arnoud van Houthem von Walram besitzt, als Lehen übertragen.
Walram, Herr van Valkenburg und Monschau, kündigt an, daß er Arnoud van Houthem dreißig Morgen des Waldes von Buchoit zu Lehen gegeben hat , die er ihm auf Anraten seiner Berater Arnoud, Herr van Stein, Gozewijn van Borgharen, Jan van Haasdal, Ritter, und Raas van Printhagen, zusammen mit den anderen Lehen, die Arnoud von ihm hat, verkauft hat.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 179, Reg. Nr. 16.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1º von einer Hand aus dem 15. Jahrhundert: De XXX bonaria terre. - 2º von einer Hand ausdem 17. Jahrhundert: 1273.
Siegel: ein Hängesiegel, angekündigt, nämlich: S1 von Walram, Herr van Valkenburg und Monschau, aus weißem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 158-159.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
a. Franquinet, aufgeziechnetes Inventar von Sint-Gerlach, IV, 21, Nr. 16, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Inventar Sint-Gerlach, 73, Reg. Nr. 16. - Idem,Chronologische Liste, 66, Reg. Nr. 164.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 21
Engelbert van Isenburg, Erzdiakon von Lüttich, und Meister Reinier, Scholaster in Tongeren und Provisor von Hendrik III., Bischof von Lüttich, beenden nach sorgfältiger Untersuchung den Streit zwischen dem Erzdiakon einerseits und den Kanonikern und Nonnen von Thorn andererseits über den Erhalt des Zehnten von Mertersem und seiner Zugehörigkeit. Nur der Zehnte von Gilze, Burgst und Overveld, der im Zehntgebiet der Kirche von Mertersem liegt, gehört dem Pfarrer der Kirche von Gilze. Der Rest des Zehnten von Mertersem wird für immer dem Zuwachs der Präbenden der Kanoniker und Klosterschwestern von Thorn zufallen.
Engelbert van Isenburg, Erzdiakon von Lüttich, und Meister Reinier, Scholaster in Tongeren und Provisor von Hendrik III., Bischof von Lüttich, schlichten den Streit zwischen dem Erzdiakon auf der einen und den Kanonikern und Klosterschwestern von Thorn auf der anderen Seite über den Zehnten von Mertersem, Burgst und Overveld.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 2222.
Ausgabe
a. Dillo-Van Synghel, ONB II, 379-381, Nr. 1060, nach A.


Nummer 21
Hendrik I., Herzog von Lothringen und Markgraf, bestätigt auf Bitten des Abtes und des Klosters von Kloosterrade und seines Onkels Hendrik III, Herzog von Limburg, die Schenkung der Pfarrkirche von Lottersum und der Zehnten - dazu auch das Recht, andere Güter die zur Kirche gehören, nachträglich zu erwerben. Diese Schenkung wurde der Abtei von seiner Urgroßmutter Jutta, der Witwe von Walram II., Herzog von Limburg, gemacht, als sie in das Kloster eintrat, und wurde später von ihren Nachkommen bestätigt.
Hendrik I., Herzog von Lothringen und Markgraf, bestätigt auf Bitten des Abtes und des Klosters von Kloosterrade und seines Onkels Hendrik III, Herzog von Limburg, die Schenkung der Pfarrkirche von Lottersum und der Zehnten - dazu auch das Recht, andere Güter die zur Kirche gehören, nachträglich zu erwerben. Diese Schenkung wurde der Abtei von seiner Urgroßmutter Jutta, der Witwe von Walram II., Herzog von Limburg, gemacht, als sie in das Kloster eintrat, und wurde später von ihren Nachkommen bestätigt.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 802, 3.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 116-119, Nr. 53, nach A.
Authentizität
Zur möglichen Unechtheit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 21
Die Schöffen von Maastricht beurkunden, dass Benedicta, Witwe (von Adelbert van Wyck), und ihre Söhne Godfried und Jan, Priester, einen jährlichen Cijns von fünf Lütticher Schilling und zwei Kapaunen, der auf einem Haus in Wyck (bei Maastricht) lastet, an Jan van Wyck, Sohn von Basilea, verkaufen.
Die Schöffen von Maastricht beurkunden, dass Benedicta, Witwe (von Adelbert van Wyck), und ihre Söhne Godfried und Jan, Priester, einen jährlichen Cijns von fünf Lütticher Schilling und zwei Kapaunen, der auf einem Haus in Wyck (bei Maastricht) lastet, an Jan van Wyck, Sohn von Basilea, verkaufen.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 443.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Littera V solidorum et II caponum tenetur relicta quondamAlbertiin Wiic. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: n 39. -3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 286 / 1257.
Siegel: zwei h"ngend befestigte Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Boudewijn de Molendino, Schöffe von Maastricht, aus braunem Wachs, beschädigt. - S3 erstes Siegel von Daniel supra Forum, Schöffe von Maastricht, aus braunem Wachs, beschädigt; und eine Befestigungsstelle, vermutlich für das angekündigte Siegel von Godfried, Sohn von Frau Osa, Schöffe von Maastricht (LS2). Für eine Beschreibung und Abbildung von S1 und S3 siehe Venner, 'Zegels klooster Sint-Gerlach', 161-162, und Idem, 'Maastrichtse schepenzegels', 170-171, Abb. 14, jeweils.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgaben
a. Doppler, 'Schepenbrievens', 19-20, Nr. 1, nach A. - b. Nève, De derteinde-eeuwse schepenoorkonden, 11-12 (mit unvollständiger Übersetzung), Nr. 1257.05.12, nach A.
Zusammenfassungen
Haas, Chronologische lijst, 51, Nr. 110. - Nuyens, Inventaris Sint Servaas, 100, Nr. 443.
Identifizierung
Laut der dorsalen Notiz ist Benedicta die Witwe von Adelbert van Wyck.
Herkunft
Diese Charta wurde von einem Skriptor verfasst, der Schöffenurkunden von Maastricht muniert für das Wittevrouwenklooster in Maastricht am 22. Dezember 1256 (siehe Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D030, archief klooster der Wittevrouwen in Maastricht, 1253-1796, Inv. Nr. 59), für die Predikheren in Maastricht vom 6. November 1263 (siehe Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D028, archief klooster der Predikheren in Maastricht, 1261-179, Inv. Nr. 83) und für zwei Beginen vom 25. Januar 1267 (siehe collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 26). Dieser Skriptor kann also im Umfeld des Maastrichter Schöffengerichts verortet werden.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist schwer zu erkennen.


Nummer 22
Engelbert von Isenburg, Erzidiakon der Diözese Lüttich, ordnet an, dass der Pfarrer von Meerssen eine vorgeschlagene Ernennung eines Pfarrers in Oirsbeek drei Festtage lang verkünden muss, damit andere am 12. Juni beim Erzdiakon Einspruch erheben können und das Kloster Sint-Gerlach in Houthem eine andere Ernennungsentscheidung treffen kann. Denn Walram, der junge Herr van Valkenburg und Monschau, hatte zuvor das Patronatsrecht von Oirsbeek an das Kloster Sint-Gerlach geschenkt.
Engelbert von Isenburg, Erzdiakon von Lüttich, befiehlt dem Pfarrer von Meerssen, die Begnadigung des Pastorats von Oirsbeek, das Walram, der junge Herr van Valkenburg und Monschau, dem Propst, der Magistra und dem Konvent von Sint-Gerlachgegeben hatte, für drei Festtage zu verkünden, damit andere Interessenten am 12. Juni vor dem Erzdiakon Einspruch erheben können und das Kloster darauf zurückkommen kann.
Original
[A]. Nicht vorhanden, dargestellt durch D, versiegelt mit einem Siegel.
Abschriften
[B]. 1376 Januar 25, nicht verfügbar, aber bekannt aus C, Urkunde des Offizials von Lüttich und des Erzdiakons von Kempen, nach [A].-C. 25. Januar 1376, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 173, Reg. Nr. 71, beglaubigte Abschrift durch Albert Loze von 's-Hertogenbosch, öffentlicher und kaiserlicher Notar, auf Antrag des Offizials von Lüttich und des Erzdiakons von Kempen, erste Urkunde, an [B]. - D. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 275-276, unter der Überschrift: Collatio iuris patronatus ecclesie in Oirsbeek, und am Rande: Num. 170, unter Angabe einer Siegelstelle, zu [A]. - E]. vor 1869, nicht vorhanden, aber bekannt aus b, noch vorhanden im Kirchenarchiv von Oirsbeek 1869.
Ausgaben
a. Hugo, Annales, col. 737, Nr. XVI. - b. Habets, 'Houthem-Sint-Gerlach', 213-214, Nr. 7, nach [E]. - c. Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 22, Nr. 17, nach C.
Regest
Haas, Inventar St. Gerlach, 73, Reg. Nr. 17.
Kohärenz
Zur Ernennung des Pfarrers von Oirsbeek siehe infra Nr. 23.
Textausgabe
In Ermangelung des Originals und des Fehlens von Textabschnitten im Kartular des 18. Jahrhunderts wurde der vorliegende Text auf der Grundlage der Abschrift C veröffentlicht, mit den signifikanten Varianten D, a und b in den Anmerkungen.

Nummer 22
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn verteilen auf Bitten von Jan, Propst, Gillis, Dekan, dem Erzdiakon und dem Domkapitel in Lüttich sowie mit Zustimmung von Marsilius, Gundulf und Nicolaas van Welheim, Priestern, und Koenraad, Kanoniker von Thorn, das Klostergut zur Tilgung von Schuleden..
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn verteilen auf Bitten von Jan, Propst, Gillis, Dekan, dem Archidiakon und dem Domkapitel von Lüttich sowie mit Zustimmung von Marsilius, Gundulf und Nicolaas van Welheim, Priestern, und Koenraad, Kanoniker von Thorn, das Klostergut zur Begleichung ihrer Schulden. (Deperditum)
Erwähnung
Diese Urkunde ist aus der Dispositio der Urkunde von Hildegonde, Äbtissin, und dem Konvent der Abtei Thorn von 1265 (3. April bis 26. März 25) bekannt (siehe Sammlung Thorn, Nr. 23). 23), wo die vorliegende Charta erwähnt wird: nobis ab ecclesia [***] ordinationem sive divisionem inter nos fecimus de bonis et reditibus nostris propter debita n[o]stra [***], [s]icut in [l]itteris super hoc confectis et sigillis nostris sigillatis plenius continetur.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Kohärenz
Für das Ersuchen um Bestätigung dieser Vermögensaufteilung an das Domkapitel von Lüttich, siehe Sammlung Thorn, Nr. 23.


Nummer 22
Rutger, Abt von Kloosterrade, verkündet, dass die Abtei in jüngster Zeit mehrfach Besitztümer und Einkünfte erworben hat.
Rutger, Abt von Kloosterrade, verkündet, dass die Abtei in jüngster Zeit mehrfach Besitztümer und Einkünfte erworben hat.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 824.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 122-125, Nr. 55, nach A.
Datierung und Authentizität
Zur Datierung und möglichen Ungültigkeit dieser Charta siehe die Ausgabe von Polak und Dijkhof.


Nummer 22
Schöffen von Maastricht beurkunden, dass Dirk, Mönch der Abtei Val-Dieu (in Aubel), als Prokurator von Abt und Konvent einerseits und Hendrik Herync, Bürger von Maastricht, andererseits, unter näheren Bedingungen eine Vereinbarung über die Zahlung einer jährlichen Erbschaftssteuer von einem Lütticher Pfund durch Hendrik an die Abtei getroffen haben, die von seinem Wohnsitz aan het Vrijthof (in Maastricht) zu entrichten ist.
Schöffen von Maastricht beurkunden, dass Dirk, Mönch der Abtei Val-Dieu (in Aubel), als Prokurator von Abt und Konvent einerseits und Hendrik Herync, Bürger von Maastricht, andererseits, unter näheren Bedingungen eine Vereinbarung über die Zahlung einer jährlichen Erbschaftssteuer von einem Lütticher Pfund durch Hendrik an die Abtei getroffen haben, die von seinem Wohnsitz aan het Vrijthof (in Maastricht) zu entrichten ist.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archie kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 444.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1ovon einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Henricus dictus Herinc. - 2o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: De XX solidis supra domum in qua moratur Manesius et alia domo contigua. - 3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 333 / E 44. - 4o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 1261. -5o von einer möglichen Hand des 16. Jahrhunderts: (nach durchgestrichenen Worten) MR G.
Siegel: zwei hängend befestigte Siegel, angekündigt, nämlich: S1 von Boudewijn de Molendino, Schöffe von Maastricht, aus braunem Wachs, beschädigt. - S2 von Godfried, Sohn von Frau Osa, Schöffe von Maastricht, aus braunem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1 und S2 siehe Venner, 'zegels klooster Sint-Gerlach', 161-162 und 162.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
a. Nève, De dertiende-eeuwse schapenoorkonden, 13-14 (mit unvollständiger Übersetzung), Nr. 1262.01.23, nach A.
Zusammenfassungen
Doppler, "Schepenbrieven Supplement", 80, Nr. 1805. - Haas, Chronologisch lijst, 52, Nr. 115. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 101, Nr. 444.
Datierung
Die Verwendung des Osterstils in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII.
Herkunft
Diese Urkunde wurde von einem Schreiber verfasst, der die Schöffenurkunden aus Maastricht für das Wittevrouwenklooster in Maastricht vom 31. März 1253, vom 28. Oktober 1255, vom 27. Februar 1256, vom 29. Juli 1260, vom 24. November 1262 und vom 13. Januar 1266 prägte (siehe Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D030, archief Wittevrouwenklooster Maastricht, 1253-1796, Inv. 30, 58, 38, 60, 61-1 und 32), für einen Priester in Maastricht vom 6. September 1265 (siehe Collectie Sint-Servaaskapittel, Nr. 25), sowie eine Urkunde von Manegold, Komtur des Deutschen Ordens in Mechelen, zugunsten des Wittevrouwenklooster vom 24. November 1262 (siehe Ibidem, idem, Zugang Nr. 14.D030, archief Wittevrouwenklooster Maastricht, 1253-1796, Inv.-Nr. 61-2). Dieser Skriptor kann also im Umfeld des Maastrichter Schöffengerichts verortet werden.


Nummer 23
Engelbert von Isenburg, Erzdiakon der Diözese Lüttich, teilt Anselm, Dekan des Klerus von Susteren, mit, dass er Theobald, Kanoniker von Sint-Gerlach in Houthem, aufgrund des Todes seines Vorgängers Arnoud van Haren zum neuen Pfarrer von Oirsbeek ernannt hat. Theobald wurde vom Propst und Konvent des Klosters Sint-Gerlach für diese Aufgabe vorgeschlagen. Erzdiakon Engelbert weist Dekan Anselm an, Theobald tatsächlich in dieses Hirtenamt zu setzen und ihm eine schriftliche Bestätigung zukommen zu lassen.
Engelbert van Isenburg, Erzdiakon von Lüttich, teilt Anselm, Dekan van Susteren, mit, daß er auf Empfehlung des Propstes und des Konvents von Sint-Gerlach (in Houthem), Patrone der Kirche von Oirsbeek, aufgrund des Todes von Arnoud van Haren, Pfarrer von Oirsbeek, Theobald, Kanoniker von Sint-Gerlach, zum Pfarrer dort ernannt hat, und er weist ihn an, Theobald in den tatsächlichen Besitz einzusetzen.
Original
[A]. Nicht verfügbar.
Abschriften
[B]. 1376 Januar 25, nicht verfügbar, aber bekannt aus C, Urkunde des Offizials von Lüttich und des Erzdiakons van Kempen, an [A]. - C. 1376 Januar 25, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 173, Reg. Nr. 71, beglaubigte Abschrift durch Albert Loze von 's-Hertogenbosch, öffentlicher und kaiserlicher Notar, auf Antrag des Offizials von Lüttich und des Erzdiakons van Kempen, zweite Urkunde, an [B]. - D. 1735, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, archief klooster Sint-Gerlach te Houthem, Inv. Nr. 1 (cartularium) = Privelegien ende register der obligatien en andere erffcontracten des adelijcken cloosters van St. Gerlach, S. 276-277, unter der Überschrift: Institutio fratris Thibodonis, canonici regularis ecclesie sancti Gerlaci, ordinis Premonstratensis, und am Rande: Num. 171, unter Angabe einer Siegelstelle, zu [A].
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Zusammenfassungen
Franquinet, Aufgezeichnetes Inventar St. Gerlach, IV,22-23, Nr. 18. - Haas, Inventar St. Gerlach, 74, Reg. Nr. 18.
Kohärenz
Zur Schenkung des Patronatsrechts der Kirche von Oirsbeek an das Kloster Sint-Gerlach in Houthem, siehe infra Nr. 22.
Textausgabe
In Ermangelung des Originals wird der vorliegende Text auf der Grundlage der Abschrift C veröffentlicht, mit den signifikanten Varianten von D in den Anmerkungen.


Nummer 23
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn geben bekannt, daß Jan, Propst, Gillis, Dekan, der Erzdiakon und das Domkapitel in Lüttich festgestellt haben, daß die Abtei durch viele schwere Schulden belastet ist. Um diese Schulden zu tilgen, haben Äbtissin und Konvent auf Veranlassung von Jan, Gillis, dem Erzdiakon und dem Domkapitel, auf Geheiß der Klostergemeinschaft und auf Anraten der Priester Marsilius, Gundulf und Nicolaas van Welheim sowie des Kanonikers Koenraad von Thorn eine Übersicht über die Güter und Einkünfte erstellt, mit der die Schulden getilgt worden sind. Sie bitten Jan, Gillis, den Erzdiakon und das Domkapitel in Lüttich, diese Aufteilung der Güter und Einkünfte zu genehmigen.
Hildegonde, Äbtissin, und der Konvent der Abtei Thorn bitten das Domkapitel zu Lüttich, die Teilung der klösterlichen Güter zu genehmigen, die auf Antrag von Jan, Propst, Gillis, Dekan, dem Archidiakon und dem Domkapitel zu Lüttich sowie mit Zustimmung von Marsilius, Gundulf und Nicolaas van Welheim, Priester, und Koenraad, Kanoniker von Thorn, vorgenommen wurde.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 34. Stark beschädigt mit Verlust des Textes.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1ovon einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: Supplicatio ad capitulum Sancti Lamberti ut dignetur divisionem inter abbatissam et capitulum approbare, 1265. - 2ovon einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: S durchgestrichen, Z.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, nicht angekündigt, nämlich S2 von Hildegonde, Äbtissin von Thorn, aus weißem Wachs,stark beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung von S2, siehe Venner, 'Siegel Thorn', 33. Da sich das Siegel ganz rechts auf dem Pergament befindet, wurde höchstwahrscheinlich auch auf der linken Seite des Originals ein Siegel angebracht.
Ausgaben
a. Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 28-29, Nr. 18 (datiert 1265), nach A. - b. Habets, Archiv Thorn, 27, Nr. 34 (datiert 1265), nach A und a.
Regest
Haas, Chronologisches Verzeichnis, 57, Nr. 131 (datiert 1265).
Datierung
Die Verwendung des Osterstils durch kirchliche Einrichtungen in der Diözese Lüttich wurde angenommen, siehe Camps, ONB I, XXI, und Dillo und Van Synghel, ONB II, XVII.
Ursprung und Kohärenz
Diese Urkunde wurde von einem Skriptor der Abtei Thorn mundiert, der von 1262 bis 1273 tätig war. Um diesen Skriptor ausfindig zu machen, siehe ,Thorn Nr. 17.
Die vorliegende Urkunde bezieht sich auf eine Urkunde der Äbtissin und des Konvents von Thorn, in der die Verteilung der Klostergüter zur Begleichung von Schulden geregelt wird, siehe Sammlung Thorn, Nr. 22.
Textausgabe
Einige Lücken in A wurden gefüllt, um a zu drucken, als diese Passagen noch lesbar waren.


Nummer 23
Hendrik III., Herzog van Limburg und Markgraf van Aarlen, verkündet den mehrfachen Erwerb von Gütern durch Rutger, Abt von Kloosterrade.
Hendrik III., Herzog van Limburg und Markgraf van Aarlen, verkündet den mehrfachen Erwerb von Gütern durch Rutger, Abt von Kloosterrade.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 825.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 138-140, Nr. 63, nach A.


Nummer 23
Dirk, Abt von Siegburg, teilt Ludwig, Dekan, und dem Sint-Servaaskapitel in Maastricht mit, dass sie anerkennen, dass der strittige Zehnte der Güter, genannt Manewerc, in Güls, wie auch der andere Zehnte von Güls, dem Kapitel gehört.
Dirk, Abt von Siegburg, teilt Ludwig, Dekan, und dem Sint-Servaaskapitel in Maastricht mit, dass sie anerkennen, dass der strittige Zehnte der Güter, genannt Manewerc, in Güls, wie auch der andere Zehnte von Güls, dem Kapitel gehört.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 339.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 15. Jahrhundert: De decima de Gulse. - 2o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: C/II. - 3o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: Littera Theodorici, abbatis Siburgensis, quibus decimas de omnibus suis bonis prestandas recognosci / B II und 1263.
Siegel: eine Bestätigung, vermutlich für das angekündigte Siegel von Dirk, Abt von Siegburg (SD1).
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgaben
a. Wisplinghoff, Urkunden Siegburg, 256, Nr. 142, nach A. - b. Hardt, Urkundenbuch Mittelrheinischen Territorien, 323-324, Nr. 469, nach A.
Zusammenfassungen
Doppler, "Verzameling", 306-307, Nr. 173. - Haas, Chronologische lijst, 54, Nr. 123. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 90, Nr. 339.
Kohärenz
Für die in der Dispositio von ( 25. Dezember 1188- ) 1189 (23. September )erwähnte Urkunde über den Streit um den Zehnten in Güls zwischen dem Sint-Servaaskapitel und der Abtei Siegburg, siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 8.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist schwer zu erkennen.


Nummer 24
Wilhelm, Verwalter, und der Konvent von Sint-Gerlach in Houthem erklären, dass sie mit Zustimmung des Dekans und des Kapitels der St. Servatius-Kirche in Maastricht eine Mauer um ihr Kloster auf dem freien Gelände des Kapitels errichtet haben. Zu diesem Zweck haben sie von diesem Grundbesitz sowohl unter der Mauer als auch innerhalb der Mauer einen Morgen in der Länge und einer Rute in der Breite auf der Seite von Berg erworben. Dafür zahlen sie am ersten Sonntag nach St. Andreas einen jährlichen Erbzins von zwei Lütticher Pfennige an die Kirche St. Servatius in Berg. Mit dieser Genehmigung des freien Besitzes erkennen Propst und Konvent von Sint-Gerlach an, dass sie keine weiteren Rechte an den Gütern des Heiligen Servatius erworben haben.
Wilhelm, Propst, und das Kloster Sint-Gerlach (in Houthem) erklären, daß sie mit Zustimmung des Dekans und des Kapitels der Kirche Sint-Servaas in Maastricht, im Allodium des Kapitels eine Mauer um ihr Kloster auf der Seite von Berg errichtet haben gegen einen jährlichen Erbzins von zwei Lütticher Penning .
Original
[A]. Nicht verfügbar.
Kopie
B. 1279 September 6, Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 31, Reg. Nr. 21, Vidimus von Dekan und Kapitel der Kirche St. Servaas in Maastricht, siehe infra Nr. 25, zu [A].
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Regest
Nicht verfügbar.
Ursprung und Kohärenz
Die vorliegende Urkunde wurde zusammen mit zwei anderen Urkunden über den Bau der Mauer am selben Tag ausgestellt, siehe unten Nr. 25 und 26.


Nummer 24
Hendrik, Bischof von Utrecht, beschließt aufgrund der großen Armut der Abtei Thorn nach Rücksprache mit Juristen, daß die Äbtissin von Thorn - der das Ernennungs- und Benennungsrecht für die Kirche von Avezaath zusteht - dort einen Pfarrer ernennen wird, sobald das Amt frei wird. Der zu ernennende Geistliche muß die Priesterweihe empfangen, freiwillig auf ein anderes Benefizium verzichten und innerhalb eines Jahres nach der Ernennung in Avezaath wohnen. Der Bischof stattet den Pfarrer mit einer Pfründe (Einkommen) im Wert von einem Sechstel des großen und kleinen Zehnten von Zoelen aus, mit dem Besitz der Güter und Felder der Kirche von Avezaath, mit den Schenkungen und allen neuen Spenden an die Kirche. Alle übrigen Einkünfte der Kirche fallen den Kanonikern und Klosterschwestern von Thorn zu, damit ihre Pfründe (Einkünfte) aufgrund ihrer Armut erhöht werden.
Hendrik, Bischof von Utrecht, bestimmt, daß die Äbtissin von Thorn, die das Patronatsrecht über die Kirche von Avezaath innehat, mit Zustimmung der Kanoniker und Ordensschwestern von Thorn einen Pfarrer einsetzt, und er bestimmt auch dessen Einkommen.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 36.
Ausgabe
a. Ketner, OSU III, 433-434, Nr. 1690, nach A.


Nummer 24
Walram III., Graf von Luxemburg und La Roche und Markgraf von Arlon, schlichtet einen Streit zwischen der Abtei Kloosterrade und dem Ritter Rutger von Beggendorf, wobei die Abtei die jährliche Abgabe eines Mantels mit einer Summe von zwei Mark abkauft.
Walram III., Graf von Luxemburg und La Roche und Markgraf von Arlon, schlichtet einen Streit zwischen der Abtei Kloosterrade und dem Ritter Rutger von Beggendorf, wobei die Abtei die jährliche Abgabe eines Mantels mit einer Summe von zwei Mark erkauft.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 777.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 143-144, Nr. 65, nach A.


Nummer 24
Louis, Dekan, und das Sint-Servaaskapitel in Maastricht nehmen Arnoud Nauta von Güls und seine Frau Cristantia in ihre Bruderschaft auf und geben ihnen die Weinberge in Güls in lebenslangem Nießbrauch, die sie dem Kapitel geschenkt haben.
Louis, Dekan, und das Sint-Servaaskapitel in Maastricht nehmen Arnoud Nauta von Güls und seine Frau Cristantia in ihre Bruderschaft auf und geben ihnen die Weinberge in Güls in lebenslangem Nießbrauch, die sie dem Kapitel geschenkt haben.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief Sint-Servaaskapittel in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 340. Beschädigt mit Verlust des Textes.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand des 15. Jahrhunderts: De Gulse. - 2o von einer Hand aus dem 15. Jahrhundert: P XIIII. - 3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: B 12 und 1265. -4o von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: Littera donationis quorundam bonorum in Gulse.
Siegel: eine Befestigungsstelle, vermutlich für das angekündigte Siegel des Sint-Servaaskapitels in Maastricht (LS1).
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Zusammenfassungen
Doppler, "Verzmeling", 307, Nr. 174. - Haas, Chronologisch lijst, 55-56, Nr. 127. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 90, Nr. 340.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist schwer zu erkennen.


Nummer 25
Der Dekan und das Kapitel der Kirche Sint-Servaas in Maastricht geben bekannt, dass sie eine Urkunde des Verwalters und des Konvents von Sint-Gerlach in Houthem vom 6. September 1279 erhalten haben, und geben den Text wieder. In dieser Urkunde geht es um den Bau einer Mauer um das Kloster Sint-Gerlach.
Dekan und Kapitel der Kirche Sint-Servaas in Maastricht beglaubigen eine Urkunde der Propstei und des Klosters von Sint-Gerlach (in Houthem) vom 6. September 1279 über den Bau einer Mauer um das Kloster Sint-Gerlach und bestätigen, daß sie diese Urkunde erhalten haben.
Original
A. Maastricht, RHCL, Zugangsnummer 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv.-Nr. 31, Reg. Nr. 21. Gefüttert.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1º von der Hand aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts: H II. - 2º von einer Hand aus dem 15. Jahrhundert: De quittatione allodii unius bonarii terre siti infra muros monasterii. - 3º von einer Hand aus dem 17. Jahrhundert: 1279. - 4º von der Hand des 18. Jahrhunderts: Num. 74.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, angekündigt, nämlich: S1 Siegel des Kapitels der Sint-Servaas Kirche in Maastricht, aus grünem Wachs, beschädigt. Für eine Beschreibung und Abbildung, siehe Venner, "Siegel Kloster Sint-Gerlach", 155.
Kopie
B.1735 Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.D003, Archiv Kloster Sint-Gerlach in Houthem, Inv. Nr. 1 (Kartulatur), S. 120-121, unter der Überschrift: Litere domini decani et capituli sancti Servatii Traiectensis de quittatione allodii unius bonnarii terre infra murum monasterii, und am Rande: Num. 74, unter Angabe einer Siegelstelle, an A.
Ausgabe
a. Hackeng, Der mittelalterliche Grundbesitz, 320, Nr. 101, unvollständig, nach A.
Zusammenfassungen
Franquinet, aufgezeichnetes Inventar Sint-Gerlach, IV, 24, Nr. 20. - Haas, Inventar St. Gerlach, 75, Reg. Nr. 21. - Idem, Chronologisches Verzeichnis, 73, Reg. Nr. 186.
Ursprung und Kohärenz
Die vorliegende Urkunde wurde zusammen mit zwei anderen Urkunden über den Bau der Mauer am selben Tag ausgestellt, siehe infra Nr. 24 und 26. Die Schrift dieser Urkunde unterscheidet sich stark von den anderen Urkunden im Fundus von Sint-Gerlach durch die Verwendung der diplomatischen Minuskeln mit extrem langen Schäften, einer sehr großen Zwischenzeile mit zusätzlichen Abständen zwischen den Zeilen 4 und 5 und 10 und 11, der großen, stark verzierten Initiale und der seltsam umgedrehten Form der Plica. Eine mögliche Lokalisierung dieses Skriptors im Kapitel von Sint-Servaas erwies sich aufgrund des Mangels an Vergleichsmaterial aus dieser Zeit als unmöglich. Es ist nur ein Original erhalten, datiert 1275.03.20 (Maastricht, RHCL, Zugang Nr. 14.B002A, Archiv des St. Servatius-Kapitels in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 422), ausgestellt vom Propst von Sint-Servatius, und diese Urkunde ist in gotischer Kursivschrift geschrieben.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 25
Jan, Propst, Gillis, Dekan, der Erzdiakon und das Domkapitel von Lüttich fällen ein Urteil im Streit zwischen Willem van Buggenum, Pfarrer von Beek, und den Kanonikern von Thorn über die Erhebung, die Sammlung und den Besitz der Großzehnten innerhalb der Grenzen der Kirche von Beek. Wilhelm, der glaubt, daß er das Recht hat, die gesamten Großzehnten in Beek zu erheben, erklärt, daß die Domherren zu Unrecht zwei Drittel dieser Zehnten einziehen. Er verlangte daher, daß die Kanoniker von Thorn angewiesen werden, ihm den geschätzten Wert dieser Zehnten, die sie seiner Meinung nach unrechtmäßig erhoben hatten, zurückzugeben. Nach schriftlichen und mündlichen Erklärungen beider Parteien fällten Propst, Dekan, Erzdiakon und das Lütticher Domkapitel ein endgültiges Urteil zugunsten der Domherren von Thorn.
Johannes, Propst, Gillis, Dekan, der Erzdiakon und das Domkapitel von Lüttich fällen ein Urteil im Streit zwischen Willem van Buggenum, Pfarrer von Beek, und den Kanonikern von Thorn über die großen Zehnten in Beek.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 01.187A, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv.-Nr. 37.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1ovon der Hand des 16. Jahrhunderts: 1266. - 2ovon der Hand des 17. Jahrhunderts: Q. - 3ovon der Hand des18. Jahrhunderts: Maiores decimas de Beken. - 4o von Hand des 18. Jahrhunderts: B.
Siegel: ein hängend befestigtes Siegel, nicht angekündigt, nämlich: S1 des Domkapitels von Lüttich, aus braunem Wachs. Für eine Beschreibung und Abbildung von S1, siehe Venner, "Siegel Thorn", 21-23.
Abschriften
B. erste Hälfte des 15. Jahrhunderts, Ibidem, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Vrije Rijksheerlijkheid Thorn, Inv. Nr. 1628 (ehemals Cartularium Nr. 1) = Cartularium abbatiae imperialis Thorensis, 966-1600, S. 57-58 (altes fol. 33r-v), unter der Überschrift: De decima de Beke, am Rand C, zu A. - C. 18. Jh., Ibidem, Zugang Nr. 01.187B, Archiv Freies Königreich Thorn, Inv. Nr. 1629 = Codex oder Cartularium IV, 992-1762 (Band der notariellen Abschriften Abtei Thorn), S. 35-37, einfache Kopie. - D. Ibidem, idem, S. 63, unter der Überschrift: De decima de Beke, linker Rand: Copia N. 2, Abschrift, mit Erwähnung des Siegels, an A.
Ausgabe
Bisher nicht veröffentlicht.
Zusammenfassungen
Franquinet,Revidiertes Inventar Thorn, 30-31, Nr. 20. - Habets, Archiv Thorn, 30-31, Nr. 20. - Haas, Chronologisches Verzeichnis, 58, Nr. 135.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist nicht klar erkennbar.


Nummer 25
Konrad, Bischof von Porto und Sint-Rufina und päpstlicher Legat, nahm die Abtei Kloosterrade mit allen ihren Gütern unter seinen Schutz und bestätigte ihr den Besitz der von Jutta und ihrer Tochter Margarete übergebenen Güter.
Konrad, Bischof von Porto und Sint-Rufina und päpstlicher Legat, nahm die Abtei Kloosterrade mit allen ihren Gütern unter seinen Schutz und bestätigte ihr den Besitz der von Jutta und ihrer Tochter Margarete übergebenen Güter.
Original
A. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.D004, Archiv der Abtei Kloosterrade, Inv.-Nr. 945.
Ausgabe
a. Polak und Dijkhof, Oorkondenboek Kloosterrade, 153-154, Nr. 72, nach A.


Nummer 25
Die Schöffen von Maastricht beurkunden, dass Dirk, Mönch der Abtei Val-Dieu (in Aubel), mit Zustimmung des Abtes und des Konvents ihr Haus und ihren Hof, die Hendrik van Hagen, Priester, gehörten und sich auf dem Vrijthof (in Maastricht) befanden, an Lambert supra Forum, Priester, für die Dauer seines Lebens überlässt und ihm einen jährlichen Cijns von zwölf Lütticher Schilling aus einem anderen Haus auf dem Vrijthof, in dem Adam wohnt, gewährt.
Die Schöffen von Maastricht beurkunden, dass Dirk, Mönch der Abtei Val-Dieu (in Aubel), mit Zustimmung des Abtes und des Konvents ihr Haus und ihren Hof, die Hendrik van Hagen, Priester, gehörten und sich auf dem Vrijthof (in Maastricht) befanden, an Lambert supra Forum, Priester, für die Dauer seines Lebens überlässt und ihm einen jährlichen Cijns von zwölf Lütticher Schilling aus einem anderen Haus auf dem Vrijthof, in dem Adam wohnt, gewährt.
Originale
A1. Maastricht, HCL, Zugang Nr. 14.B002A, archief kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, 1062-1797, Inv.-Nr. 445. Beschädigt.
Anmerkungen auf der Rückseite: 1o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Lambertus, presbiter, recepit a domo VallisDeiquoad mortem suam unam domum inTraiectocoram scabinis Traiectensibus. - 2o von einer Hand aus dem 14. Jahrhundert: Littera de domo Iohannis de Libra? [Atrium. -3o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: 1265. -4o von einer Hand aus dem 16. Jahrhundert: m 23.
Siegel: zwei Befestigungsstellen, vermutlich für die angekündigten Siegel von Boudewijn de Molendino und Godfried, Sohn von Frau Osa, Schöffen von Maastricht (LS1 und LS2).
[A2]. nicht verfügbar, aber bekannt aus der Corroboratio von A1, Kopie für die Abtei Val-Dieu.
Kopie
Nicht verfügbar.
Ausgabe
a. Nève, De dertiende-eeuwse schepenoorkonden, 34-35 (mit unvollständiger Übersetzung), Nr. 1265.09.06, zu A1.
Zusammenfassungen
Doppler, "Schepenbrieven Supplement", 80-81, Nr. 1806. - Haas, Chronologische lijst, 56, Nr. 130. - Nuyens, Inventaris Sint-Servaas, 101, Nr. 445.
Herkunft
Diese Urkunde wurde von einem Skriptor geschrieben, der die Maastrichter Schöffenurkunden mundierte, und befindet sich in der Umgebung des Maastrichter Schöffengerichts, siehe Collectie Sint-Servaas, Nr. 22.
Textausgabe
Der Unterschied zwischen c und t ist schwer zu erkennen.
Es gibt keine Einträge in unserer Datenbank, die den von Ihnen verwendeten Suchbegriffen oder Filtern entsprechen. Setzen Sie alle Filter zurück und versuchen Sie es erneut.
Partner




Spender







.avif)









